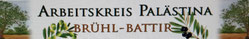|
Die Titel werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach den Namen der Autor*innen bzw. Herausgeber*innen aufgeführt, gegebenenfalls nach dem ersten Namen.
Einige Titel sind auch als Lizenzausgabe in der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erschienen. Inhaltlich sind diese in jeder Hinsicht identisch mit den Ausgaben im Buchhandel. Sie sind besonders preisgünstig, aber das Kontingent ist begrenzt. Siehe www.bpb.de/shop/
|
Ü B E R S I C H T
über die Sachbücher, die im Anschluss ausführlicher vorgestellt werden:
Asseburg, Muriel / Busse, Jan:
Der Nahostkonflikt. Geschichte, Positionen, Perspektiven
- Baram, Nir:
Im Land der Verzweiflung. Ein Israeli reist in die besetzten Gebiete
Baroud, Ramzy (Hg.):
These chains will be broken. Palestinian stories of struggle and defiance in Israeli prisons
- Dachs, Gisela: israel kurzgefasst
- Edlinger, Fritz (Hg.):
Palästina – Hundert Jahre leere Versprechen. Geschichte eines Weltkonflikts
- Gardi, Tomer: Stein, Papier. Eine Spurensuche in Galiläa
- Nathan, Susan: Sie schenkten mir Dornen. Ausgegrenzt im Land der Verheißung
- Pappe, Ilan: Die ethnische Säuberung Palästinas
- Schliwski, Carsten: Geschichte des Staates Israel
- Shavit, Ari: Mein gelobtes Land. Triumph und Tragödie Israels
- Vieweger, Dieter:
Streit um das Heilige Land. Was jeder vom israelisch-palästinensischen Konflikt wissen sollte
- Waldman, Ayelet / Chabon, Michael (Hg.):
Oliven und Asche. Schriftstellerinnen und Schriftsteller berichten über die israelische Besatzung in Palästina.
- Wild, Petra:
Apartheid und ethnische Säuberung in Palästina: Der zionistische Siedlerkolonialismus in Wort und Tat
- Zang, Johannes: Unter der Oberfläche. Erlebtes aus Israel und Palästina
- Zang, Johannes: Erlebnisse im Heiligen Land. 77 Geschichten aus Israel und Palästina
- Zertal, Idith / Eldar, Akiva: Die Herren des Landes. Israel und die Siedlerbewegung seit 1967
- Zuckermann, Moshe: „Antisemit!“ Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument
Asseburg, Muriel / Busse, Jan:
Der Nahostkonflikt. Geschichte, Positionen, Perspektiven
C.H.Beck Wissen, 4., aktualisierte Ausgabe 2021. 128 Seiten
Dr. Muriel Asseburg ist Nahost-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dr. Jan Busse ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr in München.
Der Nahostkonflikt wird in diesem Buch zunächst kurz unter konflikttheoretischem Aspekt betrachtet, wobei seine territoriale, ethno-nationalistische und religiöse Dimension aufgezeigt werden. Auf ca. 30 Seiten werden sodann die „Stationen des Nahostkonflikts“ dargestellt, vom Zionismus des ausgehenden 19. Jhs. bis zum „Scheitern von Oslo“ und der zweiten Intifada. Einen breiten Raum nimmt die Darstellung von „Positionen und Lösungsansätzen“ ein, die bei verschiedenen Verhandlungen eine Rolle spielten. Schließlich werden „Optionen zur Regelung des Konflikts“ dargelegt und erörtert. Dabei werden auch die „Folgen des Arabischen Frühlings“ bedacht. Die Gegenwart und ein Ausblick auf die Zukunft bilden damit einen wesentlichen Schwerpunkt.
Das mit vier Karten versehene Buch wird abgerundet durch eine Zeittafel (1882-2017) und zwei recht ungewöhnliche, aber höchst interessante und aufschlussreiche Teile:
Da ist zum einen eine Übersicht über die Demografische Entwicklung, die in einer übersichtlichen Tabelle das Verhältnis der jüdischen sowie der arabischen bzw. palästinensischen Anteile an der Gesamtbevölkerung von 1882 bis 2016 zeigt.
Zum anderen weist das Literaturverzeichnis nicht nur Sachbücher auf, sondern auch „Fiktion, Graphic Novels und (Auto-) Biographien“ sowie eine Liste von Filmen, die sowohl Dokumentarfilme als auch Spielfilme umfasst.
Baram, Nir:
Im Land der Verzweiflung. Ein Israeli reist in die besetzten Gebiete
Hanser 2016. 304 Seiten
Nir Baram ist ein israelischer Journalist, Lektor und Romanautor, der sich seit vielen Jahren für die Gleichberechtigung der Palästinenser und für Frieden in Israel einsetzt. Unter anderem schreibt er für die israelische Tageszeitung Haaretz.
Ein Jahr lang hat er immer wieder die Westbank bereist. Den Anstoß dazu gab seine Beobachtung, dass „Seit den Verträgen von Oslo, und verstärkt seit dem Ausbruch der zweiten Intifada und dem Bau der Mauer, […] die Trennung zwischen den Palästinensern auf der Westbank und den Israelis immer rigoroser und systematischer geworden“ ist (S. 13). „Im Grunde ist die Westbank in den Augen der meisten Israelis zu einem Reich jenseits der hohen Berge geworden, dem Blick entzogen. Sie wissen, bestimmte Dinge geschehen dort, manchmal reden sie über die Besatzung und die Siedlungen, doch eine Vorstellung, wie die Westbank heute aussieht und wie die Menschen dort leben, haben sie nicht.“ (S. 13 f.) Baram nennt das „vor allem eine Bewusstseinssperre, die zusehends wächst“ (S. 13) Und hinsichtlich einer Bewältigung des Konfliktes stellt er völlig zu Recht fest, es sei „schwierig […], über eine Lösung zu reden, wenn man keine Ahnung hat, wie der Ort aussieht, über den man spricht“. (S. 14)
Barams Anliegen war es daher, die Realität auf der Westbank kennenzulernen und seinen Landsleuten zu vermitteln. Dazu befragte er sowohl Palästinenser als auch jüdische Siedler nach ihren Lebensumständen, ihren Wünschen und Zukunftserwartungen; beide Seiten kommen in den zwölf Kapiteln ausgewogen zu Wort. Aus dem Mund jüdischer Student*innen zitiert er unter anderem: „Beide Völker sind mit demselben Gebiet verbunden. Wir wollen nur, dass sie [die Palästinenser] von hier verduften.“ (S. 189) – „Die Araber müssen begreifen, dass ich der Herrscher bin. […] Dem Araber stehen Rechte zu, Menschenrechte etwa, aber keine Bürgerrechte. Kein Wahlrecht.“ (S. 194) – „Das große Ziel ist ja, eine durchgehende jüdische Besiedlung von hier bis zur Jordansenke zu schaffen. […] Wenn es erst einmal eine lückenlose Kette von Siedlungen gibt, können alle reden, bis der Messias kommt, aber die Fakten geben den Ausschlag.“ (S. 250)
Am Ende seiner Reise weiß Nir Baram selbst nicht so recht, ob er „jetzt noch verzweifelter oder optimistischer“ sein soll: „Ich habe“, schreibt er, „auf dieser Reise vieles gesehen, was zur Verzweiflung Anlass gibt, habe gelernt, wie verzweigt und komplex der Besatzungsapparat ist – ein Labyrinth, in dessen Gängen man unweigerlich verloren gehen muss, und das uns zu einer Gesellschaft von Gefängniswärtern gemacht hat. Aber ich habe auch Menschen getroffen, die Hoffnung bei mir geweckt haben […]“ (S. 19) Die Überschrift des Epilogs – „Das Andauern der Dämonenzeit“ (S. 309) – klingt indes wenig hoffnungsvoll, ebenso wie der Titel des Buches.
Baroud, Ramzy (Hg.):
These chains will be broken.
Palestinian stories of struggle and defiance in Israeli prisons
Clarity Press 2020. 204 Seiten
Englisch
Dr. Ramzy Baroud ist ein us-palästinensischer Journalist, Autor und Medienberater, der für verschiedene internationale Medien arbeitet sowie weltweit Lehr- und Forschungsaufträge an verschiedenen Universitäten wahrnimmt. Gegenwärtig (2020) übt er einen Lehr- und Forschungsauftrag an der Zaim-Universität in Istanbul und am Afro-Middle East Centre in Johannesburg, Südafrika, aus.
Das Vorwort stammt von Khalida Jarrar, einer palästinensischen Politikerin. Sie ist Mitglied des Palästinensischen Legislativrats und dort gegenwärtig Leiterin des Komitees für inhaftierte Palästinenser. Außerdem vertritt sie ihr Land als Beobachterin im Europarat. Mehrfach war sie in israelischen Gefängnissen inhaftiert im Zuge von Verwaltungsmaßnahmen der israelischen Behörden, ohne formale Anklage. – Das Nachwort hat Richard Falk geschrieben, emeritierter Professor für internationales Recht an der Princeton University (USA). Von 2008 bis 2014 war er UN-Sonderberichterstatter über die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten Palästinensischen Gebieten.
These chains will be broken ist ein Buch über Menschen aus Palästina, die selber oder deren Angehörige Erfahrungen mit Aufenthalten in israelischen Gefängnissen gemacht haben. Dargestellt wird ein Mikrokosmos, bestehend aus Erfahrungen mit Besatzung und Kolonialisierung auf der einen, Widerstand, Kreativität und Hoffnung auf der anderen Seite.
In dem sehr informativen Buch wurden Erzählungen von Angehörigen und Inhaftierten gesammelt; Bilder, Zeichnungen und Gedichte – u.a. von Mahmoud Darwish – runden die Darstellung ab.
Eine
Übersichtskarte und eine genaue Beschreibung am Ende des Buchs informieren über israelische Gefängnisse, in denen PalästinenserInnen einsitzen. Hier werden als Quellen Addameer, Al
Jazeera, MiddleEast Monitor und das International Middle East Media Center genannt.
„Prison
is one of the most vicious tools used by oppressive regimes. One could say that it embodies modern- day slavery", so Prof. Dr. Sami A.Al-Arian, Direktor des Center for Islam and
Global Affaires, in dem Buch.
Zum Hintergrund dieses Buchs:
Immer mehr Kinder geraten in Israels Militärjustiz, seit 2018 wurden über 270 Minderjährige aus Palästina verhaftet. Oft werden sie mitten in der Nacht von der Armee abgeholt, die Augen werden verbunden, ihre Hände zusammengebunden, und so werden sie oft stundenlang verhört, ohne dass sie einen Familienangehörigen oder einen Anwalt hinzuziehen können (Quelle: Amnesty International). Laut der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem gibt es auch Folter, Misshandlungen und sexuelle Übergriffe.
UNICEF
und weitere Menschenrechtsorganisationen berichten, dass seit 2018 über 700 Minderjährige durch israelische Militärbehörden strafrechtlich verfolgt wurden. Seit 2012 wurden über 12.000 Kinder und
Jugendliche aus Palästina inhaftiert.
Am
bekanntesten ist sicher der Fall der 16jährigen Ahed Tamimi, die zu acht Monaten Haft verurteilt wurde, weil sie einen Soldaten geschlagen hatte, der das Grundstück ihrer Familie nicht
verlassen wollte.
Rezension von Ursula Mindermann,
Vizepräsidentin der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft
Dachs, Gisela:
israel kurzgefasst (Ursprünglich: Kurzgefasst: Israel für die Hosentasche)
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2016. 192 Seiten
Bestellnummer 2048
Dr. Gisela Dachs ist Publizistin, Sozialwissenschaftlerin und Dozentin an der Hebräischen Universität Jerusalem. Sie war zwei Jahrzehnte lang exklusive Israel-Reporterin der ZEIT und arbeitet heute als freie Autorin in Tel Aviv, u.a. für die NZZ am Sonntag (NZZ = Neue Zürcher Zeitung). Seit 1994 lebt sie in Israel.
Sehr kenntnisreich beschreibt die Autorin in dem kleinformatigen Buch die vielen Facetten des Lebens im heutigen Israel, angefangen von der Bedeutung des Flughafens Ben Gurion in Tel Aviv über die Unterschiede zwischen den europäischen und den orientalischen Juden, die Stellung der Frauen, das Parteiensystem und die Streitkräfte bis hin zum „schwierigen“ Verhältnis zwischen Israel und Deutschland und die Erinnerung an den Holocaust. Eingestreut sind viele farbig unterlegte Seiten, die einzelne Themen gesondert behandeln: „Hebräisch – erfolgreiche Wiederbelebung einer toten Sprache“ beispielsweise, das „Bildungssystem“, die „Lebenserwartung“ in Israel, die „Medien“, aber auch die „Siedlungspolitik“ sowie „Hamas“ und „Hisbollah“ und „Leben mit dem Terror“, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Manche Themen (etwa das politische System) sind übersichtlich grafisch aufbereitet.
Ein eigenes Kapitel widmet sich der Zivilgesellschaft, d.h. den Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Hier wird u.a. „Betselem“ (B’Tselem = „Ebenbild“) vorgestellt, „die über Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten berichtet“, aber auch die „in Deutschland wohl bekannteste zivilgesellschaftliche Bewegung […] ‚Schalom Achschav‘ (zu Deutsch ‚Frieden jetzt!‘)“. (S. 54) Schon in der Überschrift über dieses Kapitel heißt es über die NGOs: „zahlreich, aber unter Beobachtung“ (S. 54); und das Kapitel endet mit der Feststellung: „Allerdings finden solche Initiativen mehr beim internationalen Publikum als in der israelischen Öffentlichkeit Anklang.“ (S. 58)
Das Buch ist reich illustriert, mehrere Landkarten lassen die Darstellung etwa der verschiedenen Teilungsvorschläge leicht nachvollziehen. Am Ende finden sich ein über 20seitiges Glossar – von „Alijah“ über „Drusen“ und „Jom-Kippur-Krieg“ bis „Zweistaatenlösung“ –, eine Zeittafel von 1947 bis 2015 und sogar ein zweiseitiges Kleines Wörterbuch.
Ein kompaktes Buch, das auf relativ kleinem Raum eine erstaunliche Fülle an Informationen bietet.
Edlinger, Fritz (Hg.):
Palästina – Hundert Jahre leere Versprechen. Geschichte eines Weltkonflikts
Promedia Verlagsgesellschaft 2017. 208 Seiten
Das Buch enthält 13 Beiträge von internationalen Expert*innen. Zwei Kapitel hat Petra Wild beigesteuert, die im selben Verlag das Buch „Apartheid und ethnische Säuberung in Palästina“ veröffentlicht hat; dieses Buch wird auf dieser Homepage ebenfalls vorgestellt. Prominente Namen sind außerdem Omar Barghouti und Richard Falk. Der Herausgeber Fritz Edlinger ist ein österreichischer Journalist; er ist auch Herausgeber der Zeitschrift „International“ sowie Generalsekretär der „Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen“.
Die im Titel genannten „hundert Jahre“ beziehen sich auf die Balfour-Deklaration vom 2. November 1917. In ihr ließ der damalige britische Außenminister Arthur James Balfour den führenden Vertreter der Zionisten, Baron L.W. Rothschild, wissen, die englische Regierung unterstütze den Wunsch der Juden, in Palästina „eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ zu errichten. Daran erinnert Edlinger in seinem Vorwort und nennt die Deklaration einen „zweifachen Rechtsbruch“ und „doppelten Betrug“, da England keinerlei Verfügungsgewalt über das damals noch zum Osmanischen Reich gehörende Gebiet gehabt habe und außerdem die dort lebende palästinensische Bevölkerung einfach übergangen worden sei (S. 8). Kurz referiert er ferner einige markante Äußerungen führender Zionisten, beispielsweise die von Vladimir Ze’ev Jabotinsky, man müsse „die Kolonisierung gegen den Willen der palästinensischen Araber durchführen“ (S. 9 f.), sowie David Ben Gurions Aussage, er sei „für zwangsweise Umsiedlung“ (S. 11). Damit waren gewissermaßen die beiden Akzente gesetzt, die die Geschichte der zionistischen Besiedlung Palästinas prägten: Missachtung der Besitzverhältnisse und Missachtung des Rechtes eines Volkes auf freie Selbstbestimmung. Edlinger weist darauf hin, dass auch der Staat Israel immer wieder UN-Beschlüsse zu Palästina missachtet hat (S. 12 f.). Andererseits beklagt er aber auch die „internen Querelen und Positionskämpfe“ in der politischen Führung der Palästinenser (S. 14).
Die historische Linie verfolgen auch die drei ersten Kapitel, die „Die Anfänge des Zionismus“ (S. 17 ff.), die „Geschichte der Besatzung der Westbank und des Gazastreifens“ (S. 41 ff.; beide von Petra Wild) sowie die Intifada in ihren verschiedenen Stufen behandeln (Roger Heacock, S. 27 ff.). Wild macht deutlich, dass der Zionismus als „reiner Siedlerkolonialismus“ von Anfang an auf die Verdrängung der einheimischen Bevölkerung ausgerichtet gewesen sei (S. 20 f.). In dem Kapitel über die Westbank geht Wild auf die Wasserfrage ein (S. 43) und auf die palästinensischen politischen Organisationen PLO und Hamas; auf den Oslo-Prozess und den Mauerbau, die beide den „Prozess der territorialen Fragmentisierung und ‚Bantustanisierung‘ der Westbank“ (S. 47) ebenso intensiviert hätten wie der anhaltende Bau von Siedlungen; diese würden – wenn auch zunächst oft illegal und „auf palästinensischem Privatland“ errichtet – häufig im Nachhinein legalisiert (S. 51), während „Palästinenser so gut wie keine Baugenehmigungen bekommen“ (S. 43). In Bezug auf das „faktisch annektiert[e]“ Jordantal spricht sie von „gezielte[r] Vertreibungspolitik“ (ebenda). Insgesamt kommt sie zu dem – vorangestellten – Fazit: „Die Geschichte der israelischen Besatzung ist die Geschichte einer europäischen Siedlerbevölkerung, die in einem bereits von einer einheimischen Bevölkerung bewohnten Land mit Gewalt und per Gesetz versucht, die einheimische Bevölkerung möglichst vollständig zu verdrängen und sich deren Land anzueignen.“ (S. 41)
Weitere Kapitel befassen sich mit der Zivilgesellschaft in der Westbank, v.a. also – durchaus auch kritisch – mit den Nichtregierungsorganisationen (NGOs), und mit der wirtschaftlichen Entwicklung, deren fast vollständige Abhängigkeit von Israel unter der Überschrift „50 Jahre koloniales Wirtschaftsverhältnis“ dargestellt wird. In je eigenen Kapiteln werden auch die Beziehung zwischen Israel und den USA beschrieben („Der israelisch-amerikanische Würgegriff auf Palästina“; S. 133 ff.), die Rolle Russlands (S. 139 ff.) und die der Europäischen Union (S. 149 ff.). Letzterer attestiert der Autor, der palästinensische Spitzendiplomat Salah Abdel Shafi, dass sie zumindest seit 1980 die palästinensischen Rechte, v.a. das Recht auf freie Selbstbestimmung, anerkennt (S. 155 ff.), beklagt aber, dass daraus zu wenige praktische Konsequenzen gezogen würden. „Die EU muss Taten setzen“ lautet daher die Überschrift des letzten Teils seines Kapitels (S. 159 f.)
Omar Barghouti ist einer der Gründer der Bewegung Boycott, Divestment and Sanctions (BDS; auf Deutsch: „Boykott, Desinvestitionen [= Rücknahme bereits getätigter Investitionen] und Sanktionen“), die er in einem eigenen Kapitel darstellt („BDS für Menschenrechte“, S. 87 ff.). Er betont den gewaltfreien Ansatz der Bewegung und hält fest: „Die BDS-Bewegung ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert und hat durchwegs und kategorisch alle Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung abgelehnt, einschließlich des anti-jüdischen Rassismus und der Islamophobie.“ (S. 89) Er weist auf die gewalttätigen Begleiterscheinungen der Siedleraktivität in der Westbank hin (S. 90) und nennt als zentrales Ziel des BDS: „Weltweit das Bewusstsein für die von den Vereinten Nationen vorgeschriebenen Rechte des palästinensischen Volkes zu schärfen sowie den materiellen und psychologischen Preis des israelischen Regimes der Unterdrückung zu erhöhen“ (S. 92). An vielen Beispielen zeigt er auf, dass weltweit bereits viele Unternehmen ihre Investitionen in Firmen, die in der Westbank tätig sind, zurückgezogen haben. Daneben stellt er die Reaktion des Staates Israel auf BDS dar („juristische Kriegsführung“ und „intensivierte Propaganda“, S. 95) und beklagt in diesem Zusammenhang einen „zynische[n] Missbrauch der Antisemitismuskeule“ (S. 96).
Richard Falk ist ein emeritierter Professor für internationales Recht an der Princeton University (USA); von 2008 bis 2014 war er UN-Sonderberichterstatter über die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten Palästinensischen Gebieten. 2015 – noch zur Regierungszeit Barak Obamas – erhielt er zusammen mit einer Kollegin von der „UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien“ (ESCWA) den Auftrag, einen Bericht zu erstellen über „Israels Vorgehen gegen das palästinensische Volk und die Frage der Apartheid“. In dem Kapitel „Beendigung der Apartheid: Der einzige Weg zum Frieden“ (S. 115 ff.) stellt Falk dar, sie seien in ihrer Studie eindeutig zu dem Schluss gekommen, „dass der rechtliche Vorwurf der Apartheid fundiert und wohlbegründet ist“ (S. 126). Als Begründung führt der Autor „Repressive Praktiken“ an, „die das Leben einfacher Palästinenser in eine tägliche Tortur verwandelt haben“ (S. 123), spricht von einer „Vielzahl verschiedener diskriminierender Vorschriften“ sowie von „einer ganzen Bandbreite diskriminierender Staatsbürgerschaftsgesetze wie auch Verwaltungspraktiken“ (S. 124) und beklagt, „dass Palästinensern ihre grundlegenden Rechte verweigert werden, vor allem das Recht auf Selbstbestimmung“ (S. 128). Im März 2017 – zwei Monate nach dem Amtsantritt Donald Trumps – wurde der Bericht der beauftragenden Kommission vorgelegt, die die Annahme verweigerte, „und zwar“, so Falk, „ohne sich auch nur ansatzweise mit den Inhalten der Analyse auseinandersetzen zu wollen“ (S. 118). Die von Trump neu ernannte UN-Botschafterin Nikki Haley habe den Bericht verurteilt, „ohne andere Gründe zu nennen als dass der Bericht in seiner Beurteilung des Verhaltens von Israel gegenüber den Palästinensern unvorteilhaft sei“ (S. 116). Falk erkennt hier die Auswirkung eines Musters, nämlich dass schon die bloße „Kritik an Israel als Antisemitismus zu betrachten sei“ (S. 120).
Genau dieses Muster untersucht der Journalist Ludwig Watzel im vorletzten Kapitel des Buches: „Israel- und Zionismuskritik als ‚neuer‘ Antisemitismus“ (S. 161 ff.). Watzel legt dar, dass unter Antisemitismus ursprünglich „das Vorurteil oder der Hass auf Juden wegen ihres Jude-Seins“ zu verstehen sei (S. 161), dass es aber mittlerweile „primär darum [gehe], jegliche Kritik an der menschenverachtenden Politik der israelischen Regierung gegenüber dem palästinensischen Volk als ‚Antisemitismus‘ zu brandmarken“ (S. 162). Darin sieht Watzel eine willkürliche Verwendung und Instrumentalisierung des Begriffs; Omar Barghouti hatte daher von der „Antisemitismuskeule“ gesprochen (s.o.). Dass die Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus aber nicht haltbar sei, macht der Autor u.a. deutlich mit einem Hinweis auf „die ultraorthodoxe jüdische Gruppe ‚Naturei Karta‘ (= „Wächter der Stadt“, gemeint: Jerusalem; andere Schreibweise: Neturei), die vehement antizionistisch ist“ (S. 166). Ausführlich stellt Watzel schließlich die verschiedenen Mittel dar, mit der eine „zionistische Israellobby“ gegen Kritiker vorgeht: „Diffamierung, Denunziation, Lüge, […] Verdrehung von Tatsachen“ und massives Mobbing; Watzel spricht hier von einer „politischen Vernichtung von Israelkritikern“ (S. 172).
Zum sog."neuen Antisemitismus" siehe auch das Buch "'Antisemit!' Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument" von Moshe Zuckermann, das ebenfalls auf dieser Homepage vorgestellt wird.
Im letzten Kapitel des Buches, „Die Krise und der Weg zum Sieg“ (S. 177 ff.), stellt der in Gaza geborene langjährige palästinensische UN-Botschafter Nasser al-Kidwa zehn Punkte vor, deren Erfüllung eine „politische“ Lösung des Konfliktes (S. 182) ermöglichen könnten.
Gardi, Tomer:
Stein, Papier. Eine Spurensuche in Galiläa
Rotpunktverlag 2013. 296 Seiten
Tomer Gardi ist ein israelischer Schriftsteller. Geboren wurde er im Kibbuz Dan im nördlichen Galilea, unweit der Grenze zum Libanon. Um den Kibbuz – genauer: sein Museum – geht es auch in diesem Buch.
Die beiden Begriffe im Titel benennen den Ausgangspunkt und die wesentlichen Grundlagen für Nachforschungen, die Gardi hier beschreibt: „Stein“ bezieht sich auf die Steine, aus denen das Museum des Kibbuz gebaut worden ist; „Papier“ bezieht sich auf die Akten, die der Verfasser in verschiedenen Archiven eingesehen hat, um den Hintergrund des Museumsbaus aufzuhellen. Was die beiden Institutionen – Museum und Archive – verbindet: Sie stellen Wirklichkeit dar – und kaschieren sie zugleich; mit anderen Worten: Sie zeigen, wie der Autor herausfinden wird, nicht die „wirkliche“ Wirklichkeit, sondern eine gewünschte.
Das Museum wurde aus Steinen des nahegelegenen palästinensischen Dorfes Hounin gebaut. 1948 wurden die Einwohner dieses Dorfes von israelischen Soldaten vertrieben; in diesem Zusammenhang wurden vier Frauen vergewaltigt und ermordet; die Häuser des Dorfes wurden anschließend gesprengt und die Trümmer später als Baumaterial verwendet – unter anderem für das Museum im Kibbuz Dan. Die älteren Bewohner des Kibbuz wissen das im Großen und Ganzen. Sie wissen auch, wie es zu der Vertreibung der Dorfbewohner und der Zerstörung ihres Dorfes kam: Die israelischen Soldaten, so erzählen sie, seien aus ihm heraus beschossen worden; daraufhin seien sie in das Dorf eingedrungen; das Ganze sei also eine spontane Vergeltungsaktion gewesen.
All dies erwähnt das Museum – offiziell „Museum für Natur und Geschichte“ – allerdings mit keinem einzigen Wort.
Als der Autor das bei einem Besuch im Kibbuz seiner Kindheit erfährt, fragt er sich: „warum […], wenn das Geschichts- und Naturkundemuseum aus den Steinen eines Dorfes errichtet wurde, das Hounin hieß, warum findet sich dann in diesem Museum nicht ein Hinweis auf dieses Dorf in unserer Geschichte? Warum findet sich dort nicht ein Hinweis auf die Existenz Dutzender anderer arabischer Dörfer in der Geografie der Chule-Senke? Warum hat es in der Natur und in der Geschichte, die das Museum zeigen will, niemals Araber gegeben? Was hat dieses Negieren zu bedeuten? Wie arbeiten die Kodizees? Die kollektiven Narrativstatuten? Und vor allem: Wie ist dieses Negieren, diese Verdrängung und Unterdrückung verbunden mit dem Negieren und der Unterdrückung der Araber heute bei uns, in diesem Moment, nicht in irgendeinem Krieg damals, sondern jetzt […], genau in diesem Augenblick?“ (S. 10 f.)
Gardi will Antworten und sucht deshalb verschiedene Archive auf. Zunächst das Archiv des Kibbuz Dan selbst. Hier gewinnt er schnell den Eindruck, dass es vor allem darum geht, aus der Fülle des Materials „eine Art ausgewähltes und geschlossenes Archiv zu destillieren, einen Korpus zu stiften und abzustecken“ (S. 19). Schließlich gelangt er zu einer grundsätzlichen Erkenntnis über den eigentlichen Zweck dieser Archive: „Ein System muss sich selbst schützen […] Das Archiv ist […] Bastion einer Deutungsmacht, der Herrschaft.“ (S. 21) Ähnlich, so wird ihm bewusst, funktioniert auch das Museum: Es verkörpert „ein Programm, in dem sich beinahe alles so selektiv präsentieren wie auch unterschlagen lässt. […] Eine utopische Präsentation dessen, was war, einer Vergangenheit, wie die Archonten [die „Herren“ über die Archive] sie sich wünschen“ (S. 23).
Im Staatsarchiv in Jerusalem stößt der Autor auf „das Protokoll einer Sitzung des Generaltreuhänders für die Besitzungen von Abwesenden vom 18. März 1951“ (S. 27 f.); „Abwesende“ war der gängige Begriff für die Vertriebenen und Geflüchteten. Die Treuhandstelle ist für Gardi „jene Einrichtung, die geschaffen worden war, um die Beute in geordneter Form zu verteilen“ (S. 34). In der Region Galiläa, so wurde in besagter Sitzung festgehalten, „gebe es vierhundert verlassene Dörfer, in nur rund einhundert davon habe die Jewish Agency Neueinwanderer angesiedelt. Daher müsse jetzt entschieden werden, welche Dörfer zu zerstören seien, um Baumaterialien zu gewinnen, die heute rar und kostbar seien“ (S. 28) Zerstört werden müssten sie aber – sofern nicht für weitere Neueinwanderer vorgesehen – in jedem Fall, „damit in Zukunft die […] ‚Rückkehrer’ diese nicht verwenden können, um an Ort und Stelle wieder sesshaft zu werden“ (S. 40).
Gardi sucht auch das Archiv für die Geschichte der Haganah auf. (Die Haganah – dt. „die Verteidigung“ – war eine paramilitärische zionistische Untergrundorganisation zur Zeit der Britischen Mandatsherrschaft; nach der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 ging sie in der israelischen Armee auf.) Einen weiteren Besuch stattet er diesem Archiv drei Jahre später ab, weil er in einem Vortrag gehört hatte, die Dokumente würden nicht nur archiviert, sondern auch geändert. Diese Behauptung will er überprüfen. Tatsächlich stellt er eine bestimmte Veränderung fest, und da er bei seinem ersten Besuch von einigen Dokumenten Kopien hat anfertigen lassen, kann er dies auch beweisen; konkret: Er kann beweisen, dass in einem Dokument über das Dorf Hounin eine ursprünglich enthaltene Passage über die oben erwähnten Vergewaltigungen „gelöscht ist. Zensiert“ (S. 167). Auf seine Frage nach dem Grund bekommt er von verschiedenen Mitarbeitern des Archivs unterschiedliche Antworten: Zwei Angestellte unterer Ränge erklären es mit dem „Schutz der Privatsphäre“ (S. 167, 174). Die Leiterin der Abteilung, die die Vorgaben dazu macht, was genau gelöscht werden soll – und die Gardi im Laufe des Gesprächs u.a. fragt, wer ihn denn finanziere (S. 180) – erklärt ihm dagegen, „die Information sei aufgrund von für die Sicherheit des Staates relevanten Belangen behandelt worden“ (S. 179). Der Autor kommt zu dem Schluss: „Nicht ein bürokratisches Kriterium ist bei den Verheimlichungen am Werk, sondern eine Logik anderer Art, eine traditionelle, patriarchalische Abwägung, ein Kriterium von Schmach und Ehre, von Verschwiegenheit und Geheimnis, von Besitz und Kontrolle, eine Art auf den ganzen Staat erweiterte Familienehre.“ (S. 185) Und er muss erkennen, „dass die Armee eine Institution ist, die unverhohlen ihre eigene Geschichte frisiert“ (S. 176).
Auch ein anderes Dokument findet Gardi in den Archiven, das ebenfalls das Dorf Hounin betrifft. Es belegt, dass ein Kommandant am 2. September 1948 „den Befehl zur Eroberung und Zerstörung von Hounin aufgesetzt“ hatte. „Darin befiehlt er seinen Soldaten, das Dorf zu erstürmen, ein paar Männer zu töten, Gefangene zu machen, einige Häuser in die Luft zu sprengen und niederzubrennen, was sich in Brand stecken lässt.“ (S. 197; ähnlich 43). Die „Einnahme von Hounin“, so Gardi, sei also „mitnichten das Resultat einer spontanen Rache- und Vergeltungsaktion“ gewesen; vielmehr habe man mit dem Befehl „den Beweis für die vorsätzliche Absicht, für vorherige Abwägung und Planung, mit allen Einzelheiten der Aktion“ bis hin zu der „Menge an Sprengstoff, die die Sprengmeister der Truppe aus den Arsenalen benötigen würden, um die Häuser in die Luft zu jagen“ (S. 198)
Gardi nennt sein Buch einen „Literarischen Essay“. Wie es üblich ist für diese Textsorte, ist der Stil sehr subjektiv und bisweilen ungewöhnlich, folgt nicht dem Gebot einer strengen, wissenschaftlichen Terminologie. Das macht das Lesen – man könnte sagen: angenehm, stünde dieses Wort nicht in einem zu starken Kontrast zum Inhalt. Auch die Gedankenführung ist – ebenfalls textsortentypisch – oft eigenwillig, durchzogen von mancherlei Reflexionen, die die sehr persönliche Auseinandersetzung mit den Inhalten widerspiegelt, und von manchen Abschweifungen vom eigentlichen Thema: der Darstellung des Kibbuz-Museums von Dan und dem historischen Hintergrund seiner Entstehung. Wer sich vor allem dafür interessiert, kann sich auf folgende Seiten konzentrieren: 7-45 (das Kapitel „Kapitel“), 156-217 (Kapitel „Allgemeinheitssphäre“) und 240 f.
Susan Nathan ist eine englische Jüdin, die 1999 nach Israel einwanderte. Dort lebte sie zunächst in Tel Aviv, zog aber 2002 in den Norden Israels, nach Galiläa, wo die meisten der israelischen Palästinenser leben. Einige Jahre lang wohnte sie als einzige Jüdin in dem palästinensischen Städtchen Tamra, wo sie an der örtlichen Schule Englisch unterrichtete. Ihre Erfahrungen und vor allem die Strukturen und Hintergründe, die das Leben von Palästinensern in Israel bestimmen, bilden den Schwerpunkt ihres Buches. Die Situation in der Westbank (z.B. Hebron, S. 270 ff.) und teilweise auch die im Gaza-Streifen (S. 283 ff.) kommen ebenfalls zur Sprache, spielen aber eine untergeordnete Rolle.
Dies gleich vorweg: Wer immer behauptet, den Palästinensern, die in Israel leben, gehe es doch gut, jedenfalls besser als denen, die nach 1948 in die Nachbarländer geflohen sind, denn sie lebten ja schließlich in einem hochentwickelten Land, von dessen Segnungen auch sie profitierten, wird hier eines Besseren – oder genauer gesagt: eines Schlimmeren belehrt. Schon Kapitelüberschriften wie „Bürger zweiter Klasse“ oder „Nachklang der Apartheid“ machen das deutlich.
Nathan erzählt, wie problemlos ihre Einwanderung nach Israel ablief. Sie nennt sie alija, wörtlich „Hinaufgehen“; das ist das Wort, mit dem in der hebräischen Bibel das „Hinaufgehen“ zum Tempel in Jerusalem bezeichnet wurde und das auch für die verschiedenen zionistischen Einwanderungswellen seit 1882 verwendet wird. Damit ist der religiöse Akzent des Unternehmens „Einwanderung“ gesetzt, auch wenn die ersten Zionisten-Generationen säkular waren. Die Jewish Agency in London hatte Nathan einen Button überreicht mit der Maßgabe, ihn bei der Ankunft auf dem Flughafen in Tel Aviv anzuheften. Auf ihm stand: „Ich bin heimgekehrt“ (S. 63). Damit kommt zu dem religiösen ein deutlicher politischer Akzent hinzu: Die Dokumentation des Anspruchs auf dieses Land, das ja schon immer die Heimat des jüdischen Volkes gewesen sei. Entsprechend reibungslos geht die Einbürgerung vonstatten. Denn: „Nach israelischem Recht habe ich – und mit mir jeder andere Jude auf der Welt – Anspruch auf die sofortige Staatsbürgerschaft, wenn ich mich dazu entschließe, in Israel zu leben.“ (ebd.)
Man kann die Freude gut nachvollziehen, die Nathan darüber empfindet, nun in einem Land zu leben, in dem sie als Jüdin nicht zu einer mehr oder weniger marginalisierten Minderheit gehört, wo sogar der Klempner, der in ihrer Wohnung etwas repariert, ganz selbstverständlich eine Kippa trägt. Die Freude bekommt erste Risse, als sie durch eine Stundenorganisation von israelischen Palästinensern erfährt, die in Galiläa in sehr prekären Verhältnissen leben und von deren Existenz sie zuvor noch nie gehört hatte – was einiges darüber verrät, wie in der jüdischen Diaspora über Israel gesprochen wird. Auf die arabischen Mitbürger spricht sie Freunde an, die sie inzwischen gewonnen hat und die größtenteils „links“ sind; „links“ bedeutet in Israel: freundlich und aufgeschlossen gegenüber den Palästinensern und ihren Problemen. Sie erfährt, dass viele von ihnen selbst arabische Freunde haben. Als sie Genaueres über die Beziehungen wissen will – was unternimmt man gemeinsam? worüber redet man? usw. –, sieht sie allerdings in völlig verständnislose Gesichter: Man gehe gelegentlich beim Lieblingsaraber essen und lasse sein Auto in arabischen Werkstätten reparieren, wo es billiger sei – aber doch nicht mehr! Auch bei ihren „linken“ Freunden ist also die Beziehung zu Arabern eindeutig ein „Herr-Knecht-Verhältnis“ (S. 82).
Später erfährt sie immer wieder, „dass viele prominente linke Juden an Gerechtigkeit oder am Leid der arabischen Bevölkerung gar nicht wirklich interessiert“ sind (S. 232). Und bitter hält sie fest: „Ich merkte bald, dass diese so genannten Linken Heuchler der schlimmsten Sorte sind.“ (S. 230; Auseinandersetzung mit den „Linken“ in Israel insgesamt S. 226 ff.)
Als sie ihren Freunden in Tel Aviv von ihrem Plan erzählt, für einige Jahre in ein palästinensisches Dorf zu ziehen, sind sie „ausnahmslos entsetzt“ und erklären sie für verrückt; sie werfen ihr politische Naivität vor und unterstellen ihr Profilierungssucht (S. 14). Die Beziehung kühlt sich in der Folge merklich ab, Nathan fühlt sich – wie der deutsche Untertitel schon sagt – zunehmend „ausgegrenzt“. Die Risse werden tiefer; das zweite Kapitel trägt die bezeichnende Überschrift „Das Ende einer Liebesaffäre“ – nämlich mit dem Staat Israel. Nathans ursprünglich „romantische Vorstellungen über den Zionismus und den jüdischen Staat“ (S. 69) lösen sich angesichts der Wirklichkeit, die sie erlebt, schnell auf. Sie stellt fest, dass dieses von ihr einst verklärte Land „eine zutiefst rassistische Haltung gegenüber den Arabern fördert und ein Apartheidsystem zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen durchsetzt“ (S. 103). Wie sie diesen Begriff versteht, gibt sie später mit den Worten eines jüdisch-israelischen Gesprächspartners wieder. Er meint damit nicht einfach den bei vielen Menschen vorkommenden alltäglichen Rassismus‚ sondern dessen „gesetzliche Regulierung und Umsetzung“: „Apartheid ist ein System, in dem das Parlament, die Justiz und die Polizeibehörden die Bevölkerung mit rassistischen und fremdenfeindlichen Entscheidungen konfrontieren.“ Und genau in diesem Sinne ist Israel für den Gesprächspartner ein Apartheidstaat ist (S. 196). (Die jüdisch-israelische NGO B’Tselem – „Ebenbild“ – hat in einem Positionspapier im Januar 2021 diese Kennzeichnung aufgegriffen; siehe https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid.)
Dass das dann auch den Alltag prägt, erfährt Nathan beispielsweise bei dem Taxifahrer, der sie schließlich nach Tamra fährt und der ebenfalls große Probleme hat, ihren Umzug zu verstehen (Fahrt und Ankunft in dem Ort werden im ersten Kapitel geschildert): Er fragt sie, ob sie wenigstens eine Pistole habe; denn wie ihre Tel Aviver „Freunde“ ist er sicher: „Man wird Sie umbringen“ (S. 14 f.). Das Bild der jüdischen Israelis von ihren palästinensischen Landsleuten ist eindeutig beherrscht von angstbesetzten rassistischen Vorurteilen. Nurit Peled-Elhanan hat 2012 in ihrer Studie Palästina in israelischen Schulbüchern nachgewiesen, dass dieses Bild in der Erziehung systematisch vermittelt wird (deutsche Übersetzung 2021).
In Tamra wird Nathan ohne große Umstände und sehr warmherzig in eine palästinensische Familie aufgenommen, in deren Haus sie eine Wohnung gemietet hat und wo sie bald einfach dazugehört. Nur kurz hat sie bei anderen Bewohnern des 25.000-Einwohner-Ortes mit Vorurteilen zu kämpfen oder auch mit dem Verdacht, sie sei vielleicht eine Spionin des israelischen Inlandgeheimdienstes Schin Bet. Man erfährt (im ersten Kapitel) viel Interessantes über die Bedeutung der Familien- und Clan-Strukturen, die Lebensweise bis hin zu Lieblingsgerichten, über das Kopftuch, das die Frauen in Tamra selbstbewusst als Ausdruck des Stolzes auf die eigene Weiblichkeit tragen (S. 47 ff.) – und über die äußerst beengten Wohnverhältnisse. Diese sind dadurch entstanden, dass der Staat Israel im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Land der Palästinenser konfisziert hat, um es neu entstehenden jüdischen Siedlungen im Umland zuzuschlagen. Ähnlich wie in der Westbank haben diese bei erheblich niedrigerer Einwohnerzahl durchweg erheblich mehr Raum zur Verfügung – eben auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung. Diese ist infolge der Landkonfiszierungen gezwungen, immer mehr zusammenzurücken und z.T. sogar das wenige Vieh, das ihnen geblieben ist, im Garten zu halten, weil die Ländereien, die (noch) nicht konfisziert sind, oft nicht bebaut werden dürfen, etwa aus – angeblichen – Sicherheitsgründen. Nathan spricht insgesamt von einer „aggressiven Konfiskationspolitik“ (S. 192) und resümiert, wofür in ihren Augen „der heutige Staat Israel mittlerweile steht: für „eine zwanghafte, rassistische Landgier und die Kontrolle über die Ressourcen […] Die Methoden in Tamra, Jerusalem und Hebron mögen sich unterscheiden, doch das Ziel ist immer das gleiche: die Besetzung von Land exklusiv für Juden, und zwar mit allen erdenklichen Mitteln.“ (S. 319 f.) Die Autorin sieht zunehmend, „dass Israel nicht nur eine Zuflucht und Heimat [für Juden] ist; es steht auch für die Bedeutung nackter jüdischer Macht“ über die Nicht-Juden im Land (S. 71).
Und dahinter steckt System. Nach einer Unterhaltung mit dem (jüdischen) Architekten in Haifa, der für die Stadtentwicklung Tamras zuständig ist (zu der „man offenbar niemanden aus Tamra zurate gezogen hatte“; S. 58), hält sie fest: „Er ließ durchblicken, dass die Anweisung des Innenministeriums womöglich einen geheimen Zweck verfolge […]: Möglichst viele Araber sollen auf möglichst wenig Land zusammengepfercht werden.“ (S. 59. Das passt jedenfalls zu einer Strategie, die bereits David Ben-Gurion in seinem Tagebuch skizziert hat: Man solle den Arabern das Leben so ungemütlich machen, dass sie das Land von selbst verlassen.) Nathan nennt es ein „Leben in […] Gettos“, in die „ausgerechnet der jüdische Staat […] seine arabischen Staatsbürger gepfercht hat“, was ihr „in Anbetracht unserer Geschichte“ als „die größte Ironie“ erscheint (S. 61).
Verschärft wird die Wohnungsnot, die in allen palästinensischen Ortschaften in Galiläa herrscht, durch einen weiteren Umstand: Seit der Staatsgründung ist kein einziger neuer Ort für Palästinenser gebaut worden, obwohl die palästinensische Bevölkerungszahl um das Siebenfache gewachsen ist. Über 700 neue Siedlungen wurden dagegen für jüdische Israelis gebaut. Ja mehr noch: 1965 wurde ein Planungs- und Baugesetz erlassen (S. 179 ff.). Es legt die Zahl der palästinensischen Ortschaften auf 123 fest. Weitere Orte, die über diese Zahl hinausgehen, wurden damit über Nacht „illegal“, auch wenn sie seit Generationen bewohnt sind. Sie werden nicht vom staatlichen Wasser- und Stromnetz versorgt und ihre Bewohner müssen Tag für Tag damit rechnen, dass ihre Häuser abgerissen werden. Das droht allerdings ebenfalls in den anerkannten Ortschaften. Dort werden Häuser oft „illegal“ gebaut, weil den Einwohnern vielfach nichts anderes übrig bleibt: „Arabische Familien sind gezwungen, illegal zu bauen, weil der Staat ihnen in den meisten Fällen keine Baugenehmigung erteilt.“ (S. 80) Bisweilen können sie sich durch die Zahlung größerer Summen für einige Zeit freikaufen. Das gelingt aber nicht immer: „Fast jede Woche wird gemeldet, dass die Polizei in einer arabischen Gemeinde ein paar Häuser zerstört hat. Im Jahr 2003 wurden in Israel insgesamt 500 arabische Häuser abgerissen.“ (S. 189)
Tamra war ursprünglich ein Flüchtlingslager, das – wie viele andere – nach und nach zu einem Ort mit festen Häusern ausgebaut wurde. Hier leben also „Binnenflüchtlinge“, die im Rahmen des sog. Unabhängigkeitskrieges 1948 nicht nach Jordanien oder Syrien geflohen, sondern im Land geblieben sind. Sie gelten als „anwesende Abwesende“ – Menschen, die aus ihren ursprünglichen Dörfern geflohen sind (weshalb sie zu „Abwesenden“ erklärt wurden – S. 175 –, deren Eigentum der Staat laut dem 1950 erlassenen Absentees‘ Property Law entschädigungslos konfiszieren durfte), die aber doch noch im Land „anwesend“ sind. Oft leben sie nicht allzu weit entfernt von ihren ursprünglichen Wohnorten. Diese sind in dem genannten Krieg häufig zerstört worden – insgesamt mehr als 350, viele Trümmer sind heute unter Naturschutzgebieten verborgen; viele sind aber auch erhalten geblieben, um sie neu eingewanderten Zionisten anzubieten. Zu den erhaltenen Dörfern gehört Ein Hod in der Nähe von Haifa, heute in Israel als Künstlerdorf bekannt. Zu den erschütternden Passagen in Nathans Buch gehört ein Bericht über den Besuch dieses Ortes mit der Tochter einer Familie, die aus Ein Hod vertrieben worden war. Ihre Mutter hatte Jahre zuvor versucht, noch einmal nur einen Blick in ihr altes Haus zu werfen, aber man hatte ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Eingangs wurde schon erwähnt, dass viele Menschen davon ausgehen, dass die Palästinenser in Israel es doch vergleichsweise gut hätten. Die Schilderung der Wohnverhältnisse dürfte das bereits hinreichend widerlegt haben. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang aber noch ein Blick auf Sozialleistungen, etwa das Arbeitslosengeld (S. 151 ff.).
Junge Leute unter 20 Jahren bekommen grundsätzlich kein Arbeitslosengeld. Jüdischen Israelis kann das gleichgültig sein; denn sie absolvieren nach dem Schulabschluss in der Regel ihren Militärdienst, wo sie Sold bekommen, oder sie besuchen eine Jeshiwa, also eine Thora-Schule, wofür sie ein eigenes Stipendium erhalten. Eine solche Vergütung für den Besuch einer Koran-Schule gibt es für Palästinenser nicht; und vom Militärdienst sind palästinensische Jugendliche ausgeschlossen. Deshalb ist der Anteil der jungen Palästinenser, die arbeitslos sind und keine Unterstützung bekommen, vergleichsweise hoch. Auch die Arbeitslosigkeit hat systembedingte Ursachen: Für palästinensische Schülerinnen und Schüler gibt der Staat Israel pro Jahr etwa ein Fünftel dessen aus, was er für jüdische Schülerinnen und Schüler ausgibt; entsprechend schlechter sind oft die erworbenen Qualifikationen. Und viele Berufe, beispielsweise solche im Energiesektor, die als sicherheitsrelevant eingestuft sind, sind für Palästinenser tabu; für viele andere gibt es eine Einstellungsvoraussetzung, die für sie unerfüllbar ist, nämlich das Ableisten des – s.o.: verbotenen – Wehrdienstes. (Über das Bildungswesen ausführlich S. 129 ff.) Für Nathan weitere Beispiele für „staatlich sanktionierten Rassismus“, den sie an vielen Stellen beklagt.
Arbeitslosengeld wird auch nicht gezahlt, wenn jemand Eigentum an Grund und Boden sowie ein Haus hat. Klingt zunächst plausibel, hat aber auch wieder einen Haken: 93% des Bodens gehören dem Staat Israel; die allermeisten jüdischen Israelis kaufen sich kein Land für den Hausbau, sondern pachten es. Israelisches Land zu pachten oder gar zu kaufen ist Palästinensern aber gesetzlich verwehrt. (Sie können übrigens deshalb auch nicht das ihnen durch das Absentees‘ Property Law gestohlene Eigentum zurückkaufen, das in den Besitz des Staates Israel übergegangen ist.) Sie besitzen zwar in der Regel das Haus, in dem sie wohnen, sind ansonsten aber beschränkt auf das bisschen Land, das ihnen geblieben ist – und das, s.o., infolge fortschreitender Konfiskation immer weniger wird. Es reicht vielleicht zur Ernährung der Familie und zum Überleben, aber größere Gewinne lassen sich damit nicht erzielen. Wenn nun ein Palästinenser deswegen eine Zuverdienstmöglichkeit gefunden hat, aber seine Arbeitsstelle verliert, bekommt er keinerlei staatliche Unterstützung – denn er ist ja Hausbesitzer.
So viel zu den Segnungen des Staates, von dem die israelischen Palästinenser angeblich profitieren.
Ausführlich erzählt Nathan von Begegnungen mit einer ganzen Reihe beeindruckender Persönlichkeiten, jüdischer wie auch palästinensischer, die sich für die Belange der palästinensischen Israelis einsetzen – mit großem Engagement und großer Ausdauer; aber leider kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich um den berühmten Kampf gegen Windmühlen handelt. Ähnliches gilt für israelische NGOs. Beispielsweise Yesh Gvul („Es gibt eine Grenze“), in der seit den 80er Jahren Wehrdienstverweigerer organisiert sind (S. 295 f.); die Verweigerer wandern eine Zeitlang ins Gefängnis und müssen auch danach noch berufliche und soziale Nachteile in Kauf nehmen dafür, dass sie ihrem Gewissen gefolgt sind. Eine andere Organisation – Zochrot („Wir erinnern uns“) – hat sich zum Ziel gesetzt, jüdische Israelis über das Unrecht zu informieren, das den Palästinensern angetan wurde, sie z.B. aufzuklären über die Zerstörung zahlreicher Dörfer – etwas, das in der Öffentlichkeit sonst nicht thematisiert wird und viele Israelis daher gar nicht wissen (S. 301 ff.) – oder auch nicht wissen wollen: Nathan stellt fest, „wie weit verbreitet in der israelischen Gesellschaft […] das Leugnen der Realität ist“ (S. 341).
Auch mit einer Gruppe „linker“ jüdischer Israelis in einem Kibbuz in der Nähe ihres Wohnortes Tamra kommt Nathan in Kontakt. Mit ihr macht sie dieselben Erfahrungen, die sie schon mit ihren „linken“ Freunden in Tel Aviv gemacht hatte; die Kapitelüberschrift „Die fehlende Linke“ könnte auch lauten „Das Versagen der Linken“. Ähnliches hat übrigens Omri Boehm in seinem 2020 erschienenen Buch „Israel – eine Utopie“ festgestellt: dass die Linke es immer gut gemeint, aber letztlich nichts erreicht habe. Nathan nimmt an einem „Friedensmarsch“ teil, den die Gruppe in die Westbank unternimmt (S. 243 ff.) – ein Beispiel für das, was die Autorin die „Selbstgefälligkeit der israelischen Linken“ nennt (S. 337). Im Zusammenhang mit diesem Marsch schildert sie, wie es an den Checkpoints zugeht (S. 244 f.; besonders beklemmend: S. 253 f.), wo die jungen Wehrdienstleistenden „das Gefühl der Macht einfach genieße[n]“ (S. 278). Den Gastgebern an ihrem Zielort, einem Palästinenserdorf, versichern die Kibbuzniks, sie kämen „mit Liebe und Verständnis“. Aber „Sie gaben den Palästinensern zu verstehen, dass sie die Politik aus dieser Begegnung heraushalten und sich auf die Überzeugung konzentrieren wollten, dass wir alle eine große, glückliche Familie wären.“ (S. 247) Hier wird zelebrierte Menschenliebe zur Augenwischerei; sie wird instrumentalisiert, um das politisch notwendige Handeln wegzulächeln. Auf der Rückfahrt äußert Nathan ihre Überzeugung, dass das Problem der Palästinenser nur gelöst werden könne, wenn man ihnen diesseits wie jenseits der Grenze die gleichen Rechte zugestünde, wie sie jüdische Israelis haben. Dafür erntet sie allerdings nur verständnislose, mehr noch: erboste Blicke. Ähnliches hatte sie schon vor dem Ausflug erlebt, als sie gefragt hatte, warum man denn in die Westbank gehe, anstatt sich um die Palästinenser unmittelbar vor der eigenen Haustür zu kümmern, auf deren ehemaligem Land man schließlich lebe. Nathan sagt es nicht ausdrücklich, aber man kann es erschließen: Das Gutmenschentum genießt sich leichter, wenn man es in einiger Entfernung zur Schau stellt, wo man – eben wegen der Entfernung – nicht Gefahr läuft, sich mit der Realität des eigenen Landraubs auseinandersetzen und im täglichen Klein-Klein kümmern zu müssen.
Eine der letzten Begegnungen, die Nathan schildert, ist die mit dem palästinensischen Familienvater Dschihad (S. 345 ff.). Seine Familie musste mehrfach umziehen: Aus ihrem ursprünglichen Wohnort Umm al-Fahm auf der israelischen Seite der grünen Linie 1948 vertrieben, floh sie ins Flüchtlingslager in Dschenin, in dessen Nähe Dschihad sich später ein geräumiges Haus bauen konnte. Als Israel 2002 mit dem Bau des „Sicherheitszaunes“ begann, zog er – im Besitz eines israelischen Passes – wieder nach Umm al-Fahm, wo er mit Ehefrau und fünf Kindern in einer engen Wohnung lebt. Nathan konstatiert eine überraschende Übereinstimmung: „Die Palästinenser sind in der überwältigenden Mehrheit ein Flüchtlingsvolk. […] Das Schicksal der Palästinenser spiegelt so unverkennbar das Schicksal des jüdischen Volkes im Lauf der Jahrhunderte wider, dass es mich verblüfft, warum so selten darauf hingewiesen wird. Dschihads Geschichte ist gerade deshalb so furchtbar tragisch, weil die Verantwortlichen dafür, dass er und sein Volk zu ewigen Flüchtlingen wurden, die Juden selbst sind. Israel wurde genau deshalb geschaffen, damit das jüdische Volk nicht länger eine ewig umherirrende, ewig heimatlose Nation blieb. Der Preis für die Schaffung einer solchen Heimstatt war es, das Schicksal der Juden einem anderen Volk, den Palästinensern, aufzuerlegen. Ganz gleich, wohin man sich in Israel oder in den besetzten Gebieten wendet […], man wird eine jüdische Geschichte der Enteignung und Vertreibung finden; doch die Opfer sind dieses Mal die Palästinenser.“ (S. 350 f.)
Mit der letzten Bemerkung spielt Nathan an auf eine der Gewissheiten, die man ihr als Kind vermittelt hatte: die Überzeugung, die Juden seien immer „einzigartige Opfer“ gewesen, „das ultimative und ewige Opfer aller anderen“ (S. 338). Den „Opfergedanken“ bezeichnet sie als den „Kern der modernen jüdischen Identität“ (S. 84). Während ihrer Reise über die Trennlinie zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis musste sie immer wieder erfahren, „dass sich ein Opfer auch in einen Täter oder Aggressor verwandeln kann.“ (S. 338) Deshalb fordert sie nun von ihren Glaubensgenossen: „Die israelischen Juden müssen sich […] den harten moralischen Fragen stellen, die durch die Begleitumstände der Staatsgründung von 1948 aufgeworfen wurden […] Sie müssen ihre Vergangenheit bewältigen und bereit sein, sich für diese Taten zu entschuldigen“, „die historischen Ungerechtigkeiten“ anerkennen, „die sie dem ganzen palästinensischen Volk 1948 angetan haben“ (S. 301) und die am Anfang der zionistischen Bewegung mit dem Narrativ vom „Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ begründet wurden. Mit diesem „Mantra der ersten zionistischen Führung“ war sie aufgewachsen und hatte es „während meines ganzen Erwachsenenlebens akzeptiert, bis ich nach Israel kam.“ Dort erkennt sie: „Die furchtbare Tragödie für das palästinensische Volk besteht darin, dass Israel nicht nur die Juden dazu bringen konnte, diesen Mythos als unumstößlichen Glaubenssatz zu akzeptieren, sondern auch den Rest der Welt.“ (S. 170)
Ein Anhang mit einem umfangreichen Glossar, einem kommentierten Verzeichnis „Nützlicher Websites“, unterteilt in arabische, jüdisch-arabische, jüdische und internationale, drei Landkarten sowie einem ausführlichen Register machen das Buch auch zu einem sehr praktischen Nachschlagewerk.
Ilan Pappe ist ein israelischer Historiker. 1984 übernahm er eine Professur für politische Wissenschaften an der Universität Haifa. Seit 2007 lehrt er an der Universität Exeter (England). Pappe ist einer der wichtigsten Vertreter der sog. „Neuen israelischen Historiker“, die seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts die offizielle Geschichtsschreibung des Staates Israel kritisch hinterfragen.
Am 29. November 1949 verabschiedete die UN-Generalversammlung die Resolution 181, die eine Aufteilung Palästinas in einen jüdischen und einen palästinensisch-arabischen Staat festlegte. Am 14. Mai 1948 rief David Ben Gurion die Gründung des Staates Israel aus. Das sind die entscheidenden Eckpunkte für Pappes Buch, in dem der Autor Einstellung und Verhalten der zionistischen Einwanderer gegenüber der einheimischen palästinensischen Bevölkerung vor allem in den Jahren 1947 und 1948 untersucht. Ein entscheidendes Problem „bis heute“ sieht er in der „siedlerkolonialistischen Ideologie […], die in der indigenen Bevölkerung keine gleichwertigen Menschen sieht“, wie er im „Grußwort zur deutschen Ausgabe 2019“ schreibt (S. 6 f.).
Pappe zeigt, wie vor allem Ben Gurion, später erster Ministerpräsident des Staates Israel, zusammen mit einer Beratergruppe schon lange vor der Ausrufung des neuen Staates an einem Plan arbeitete, dessen „Hauptziel […] die ethnische Säuberung ganz Palästinas [war], das die Bewegung [der Zionisten] für ihren neuen Staat haben wollte“ (S. 15). Am 10. März 1948, so Pappe, „ergingen militärische Befehl an die Einheiten vor Ort, die systematische Vertreibung der Palästinenser aus weiten Teilen des Landes vorzubereiten“ (S. 10). Sechs Monate später „waren mehr als die Hälfte der ursprünglichen Bevölkerung Palästinas, annähernd 800.000 Menschen, entwurzelt, 532 Dörfer zerstört und elf Stadtteile entvölkert“ (S. 11).
Gestützt auf intensives Quellenstudium (israelische Militärarchive, u.a. Ben Gurions Tagebücher, aber auch arabische Quellen einschließlich mündlicher Überlieferung Überlebender und ihrer Nachkommen), zeichnet Pappe detailreich nach, wie der „Plan D“ umgesetzt wurde (D steht für Dalet, den vierten Buchstaben des hebräischen Alphabets; der Plan hatte drei Vorgängerversionen). Entscheidende Grundlagen dafür waren sog. „Dorfdossiers“ und ein Netz von Kollaborateuren. Die Dorfdossiers, seit Anfang der 40er Jahre erstellt und danach ständig ergänzt und aktualisiert, gaben genaue Auskunft über jedes palästinensische Dorf: über die Größe und die Anlage, über die Bevölkerungsstruktur, über den Landbesitz der einzelnen Familien, über die Qualität der Böden und der Obstbäume (S. 38 ff.). Vor allem war mit Hilfe der Kollaborateure eine Liste der Männer in jedem Dorf erstellt worden, die sich in der palästinensischen Nationalbewegung engagierten oder gar einmal an „Aktionen gegen die Briten und die Zionisten“ teilgenommen hatten (S. 44).
Die „Säuberungen“ der Dörfer liefen im Prinzip immer nach demselben Muster ab: Ein Dorf wurde – vorzugsweise nachts – umstellt; die Einwohner wurden zusammengetrieben, die Männer von den Frauen und Kindern getrennt. Dann kamen abermals die Kollaborateure zum Einsatz: Sie hatten die Männer zu identifizieren, die auf den genannten Listen standen; diese Männer wurden sofort exekutiert. Die übrige Bevölkerung wurde aus dem Ort vertrieben; auf dem Zug Richtung Grenze (z.B. zum Libanon) oder in ein Camp wurden sie oft ihrer letzten Habseligkeiten, v.a. ihrer eventuellen Wertsachen, beraubt; in manchen Fällen kam es auch zu weiteren Gewaltexzessen, etwa Vergewaltigungen. Die verlassenen Häuser wurden anschließend gesprengt oder auch ganz dem Erdboden gleichgemacht – bestes Mittel zur Verhinderung einer Rückkehr. Manche blieben aber auch stehen und wurden Neuzuwanderern angeboten (S. 246 ff.).
Die Aktionen begannen im Dezember 1947 (S. 87 ff.) – ein halbes Jahr vor der Ausrufung des Staates Israel, also noch zur Mandatszeit der Briten, die demnach eigentlich noch für Recht und Ordnung hätten sorgen müssen. Die Säuberungen erstreckten sich nach und nach über immer weitere Gebiete: auf die Region zwischen Tel Aviv und Jerusalem, auf einen 100 Kilometer langen Küstenstreifen zwischen Tel Aviv und Haifa, wo von 64 Dörfern nur zwei stehen gelassen wurden (S. 183); auf Galiläa im Norden und dort auch auf Dörfer, die nach dem UN-Teilungsplan zum Gebiet des palästinensischen Staates gehören sollten (S. 206 ff.); zuletzt auf den Negev im Süden des Landes, wo vor allem Beduinenstämme von der Vertreibung betroffen waren.
Hatte man am Anfang noch Wert darauf gelegt, das Vorgehen als „Vergeltungsmaßnahmen“ erscheinen zu lassen – Vergeltung wohlgemerkt dafür, dass die palästinensische Bevölkerung ihr Land und ihr Eigentum verteidigte –, verzichtete man später auf diesen Vorwand und ging immer mehr zu einer unverhohlenen Politik der Entarabisierung über. Yossef Weitz, Leiter der Siedlungsabteilung im Jüdischen Nationalfonds, hatte schon 1940 als Ziel formuliert: „Die einzige Lösung ist, die Araber von hier in Nachbarländer umzusiedeln. Kein einziges Dorf und kein einziger Stamm darf ausgelassen werden.“ (S. 95 f.) Im Laufe einer längeren Tagung zur Jahreswende 1947/48, an der Weitz ebenfalls teilnahm, entschied man sich für eine noch „aggressivere Politik“: Ben Gurion gab „grünes Licht für eine ganze Serie provokativer und verheerender Angriffe auf Dörfer […], die darauf abzielten, möglichst viel Schaden anzurichten und so viel Einwohner zu töten wie möglich“ (S. 98).
Nicht nur Dörfer, auch palästinensische Viertel größerer Städte wurde gezielt entarabisiert (S. 132 ff.): Aus Jaffa, Lydda, Ramla und Haifa wurden jeweils mehrere 10.000 Menschen vertrieben – aus Haifa unter den Augen der britischen Mandatsmacht, deren Militär und Verwaltungspersonal sich hier, in der größten Hafenstadt des Landes, für den endgültigen Abzug im Mai 1948 zu sammeln begann. In den Städten wurden die „gesäuberten“ Wohnungen allerdings nicht – wie die Dörfer – zerstört, sondern neu zugezogenen Zionisten zur Verfügung gestellt; ähnlich wie die über Generationen kultivierten Ländereien mancher Dörfer, an denen Kibbuzniks Interesse zeigten.
Nach dem Ende der „Säuberungsaktionen“ war der Prozess der Entarabisierung allerdings noch nicht abgeschlossen. Vielmehr sollte, so Pappe, auch die Erinnerung an die palästinensische Vergangenheit ausgelöscht werden. Sofern auf den Trümmern palästinensischer Dörfer neue, zionistische Ortschaften gebaut wurden, sorgte eine eigens installierte „Namensfindungskommission“ dafür, dass auch von den palästinensischen Namen nichts mehr übrigblieb (S. 294 f.). Noch wirkungsvoller aber war die Anlage von Naturschutz- und Erholungsgebieten, die über den Trümmern der früheren Dörfer errichtet wurden. An vier Beispielen zeigt der Autor, wie viele und welche Dörfer auf diese Weise unter einer Decke aus heiler Natur verschwanden (S. 299 ff.).
Pappe nennt das einen „Memorizid an der Nakba“ (S. 294). „Nakba“ (= Katastrophe, Unglück) ist der Begriff, mit dem in arabischen Ländern die Vertreibung der Palästinenser aus ihren angestammten Gebieten bezeichnet wird. Der Autor wirft der Regierung des Staates Israel vor, dass sie bis heute die Tatsache dieser Vertreibung leugnet; in ihrer Anerkennung sieht er andererseits den entscheidenden Schlüssel zur Beendigung des nun seit über 70 Jahren schwelenden Konflikts.
Das Buch enthält im Anhang historisches Bildmaterial und mehrere Landkarten.
Schliwski, Carsten:
Geschichte des Staates Israel
Reclam
Universal-Bibliothek. 2., erweiterte Ausgabe 2018. 195 Seiten
Dr. Carsten Schliwski ist Judaist und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thomas-Institut der Universität zu Köln und an der Bergischen Universität Wuppertal.
In diesem Buch stellt er Entstehung und Entwicklung des Staates Israel vom Beginn der Zionistischen Bewegung mit Theodor Herzl bis zur Gegenwart dar. Ursachen und Entwicklung des Konfliktes zwischen Israel und Palästina kommen dabei auch ausführlich zur Sprache.
Jedes der fünf Kapitel beginnt mit einem „Epochenüberblick“ und jedem Unterkapitel ist eine Auflistung relevanter historischer Daten vorangestellt. Diese Elemente vermitteln bereits grundlegendes Wissen über den jeweiligen historischen Abschnitt und ermöglichen eine gute Orientierung, die es den Leser*innen erlaubt, sich gezielt – in Abhängigkeit von den eigenen Interessen – in Einzelheiten zu vertiefen. Die weiteren Ausführungen sind detailreich, sachlich und präzise. Biografische Notizen über wichtige Persönlichkeiten sind in die fortlaufende Darstellung der historischen Ereignisse eingefügt, was zu einer interessanten Auflockerung der kompakten Information über die Abfolge der Geschehnisse führt. Sechs Karten veranschaulichen die geografischen und politischen Entwicklungen. Ein Verzeichnis dieser Karten sowie ein Personen- und Ortsregister runden das Buch ab und machen es zu einem hervorragenden Informationsmedium für jeden, der sich mit der Geschichte des Staates Israel befassen möchte.
Ari Shavit:
Mein gelobtes Land. Triumph und Tragödie Israels
Bertelsmann Verlag, März 2015. 592 Seiten
Ari Shavit ist ein israelischer Journalist, der bis 2016 eine führende Position bei der Zeitung Haaretz innehatte. Für sein Buch hat er mehrere Preise bekommen, u.a. den National Jewish Book Award.
Mehrere Vorzüge zeichnen dieses Buch aus:
- Da ist zum einen die unglaubliche Fülle an historischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen FAKTEN, die der Autor ausbreitet;
- da ist zweitens die AUTHENTIZITÄT: Soweit es ihm möglich war, hat Shavit Akteure der Ereignisse sowie Zeitzeugen und Fachleute befragt und ihre – oft auch längeren – Aussagen wörtlich aufgenommen.
- Da ist drittens ein meistens ERZÄHLENDER STIL. So schildert der Autor etwa die Fahrt zu seinen Gesprächspartnern einschließlich der Landschaften, durch die er kommt, den Empfang, den man ihm bereitet, das Leben der Befragten usw. Das macht die Lektüre abwechslungsreich und kurzweilig und hilft, die Faktenfülle zu verarbeiten.
- Und da ist nicht zuletzt die OFFENE AUSEINANDERSETZUNG: Weder seinen Gesprächspartnern noch sich selbst erspart Shavit kritische Fragen, etwa zur Palästinenserproblematik. Und er gibt auch selbst Antworten. Ob man diese immer überzeugend findet, muss natürlich jede Leserin und jeder Leser für sich entscheiden. In jedem Fall aber regt es zur eigenen, intensiven Auseinandersetzung mit dem Dargestellten an.
Insgesamt bietet das Buch, das die Jahre 1897 bis 2013 umfasst, eine sehr persönliche Geschichte des Staates Israel, wie es das „Mein“ im Titel bereits signalisiert. Viele Kapitel berühren – in unterschiedlicher Ausführlichkeit und Intensität – die Palästina- bzw. Palästinenser-Frage. Auf diese beschränkt sich die folgende Besprechung.
Ein ganzes Kapitel befasst sich mit Lydda (Kap. 5). Lydda, heute Lod, war eine prosperierende arabische Stadt, als sie 1948 – im Rahmen des ersten israelisch-arabischen Krieges – von israelischen Truppen erobert wurde; und das, obwohl sie nach dem UN-Teilungsplan vom November 1947 auf dem Gebiet des zukünftigen palästinensischen Staates lag. Dabei wurden die arabischen Einwohner vertrieben; man schätzt die Zahl auf 50.000-70.000. Es war die größte Vertreibungsaktion im Rahmen dieses Krieges. (Die Zahl gilt für Lydda zusammen mit der kleineren Nachbarstadt Ramla, heute Ramle, die ebenfalls von Arabern „gesäubert“ wurde – ein Begriff, der in solchen Zusammenhängen häufiger vorkommt).
Shavit beschreibt ausführlich die unglaubliche Brutalität, mit der die israelischen Truppen vorgingen. Die Einwohner bekamen beispielsweise anderthalb Stunden (!) Zeit, ein paar Habseligkeiten zusammenzuraffen, um dann für immer ihre angestammte Heimat zu verlassen. Die Menschen – darunter viele Alte, Frauen und Kinder – mussten bei glühender Hitze 15 km weit laufen, bis sie auf jordanisches Gebiet kamen.
Das alles schildert Shavit v.a. auf der Grundlage von Interviews, die er mit beteiligten Militärs geführt hat. Er verurteilt einzelne, besonders brutale Aktionen, kommt aber bezüglich der Frage, ob die Vertreibung insgesamt gerechtfertigt gewesen sei, zu folgendem Urteil: „Die Wahrheit ist, dass der Zionismus Lydda nicht ertragen konnte; von Beginn an lag die Stadt im Widerspruch zu ihm. Wollte sich der Zionismus durchsetzen, durfte er nicht zulassen, dass es Lydda gab. Solange Lydda existierte, konnte der Zionismus nicht erfolgreich sein.“ (S. 160) Und: „Im ganzen Land waren die Dörfer der Araber immer moderner geworden, ihre Städte immer wohlhabender. Eine neue arabische Intelligenzija entwickelte ein starkes Nationalbewusstsein und begann eine höchst gefährliche, spezifisch arabisch-palästinensische Identität auszubilden.“ (S. 173)
Im Klartext heißt das: Die Zionisten wollten ein Land haben, in dem sie frei sein würden von der jahrhundertelang erfahrenen Unterdrückung und Diskriminierung, ein Land, in dem sie selbstbestimmt leben könnten. Das ist nicht nur verständlich, sondern auch völlig legitim; denn das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben gehört zu den Grundrechten des Menschen. Aber: Um dieses Ziel zu erreichen, traten sie dasselbe Grundrecht eines anderen Volkes, nämlich der Palästinenser, mit Füßen. Das eigene Nationalbewusstsein forderte sein Recht; und das entstehende Nationalbewusstsein der Palästinenser wurde dabei als Bedrohung empfunden, die es zu beseitigen galt.
Auch die Gründung zweier der ältesten Kibbuzim beschreibt Shavit recht detailliert: Ein Harod im Norden und Hulda, unweit Lydda.
Geradezu euphorisch und überschwänglich stellt er – auf der Grundlage von Dokumenten aus dem örtlichen Archiv – die enorme und zweifellos bewundernswerte Leistung bei der Urbarmachung des kargen Landes im sumpfigen und malariaverseuchten Tal des Harod dar (Kap. 2). Allerdings war dieses Tal keineswegs unbewohnt; hier lagen mehrere palästinensische Dörfer und Weiler. Um es in Besitz zu nehmen, gingen die jungen Zionisten strategisch sehr geschickt vor – aus ihrer Sicht: Zunächst wurde ein einfaches Zeltlager (gleichwohl mit Stacheldraht umzäunt) „in der Nähe der Quelle angelegt, um die uneingeschränkte Kontrolle über die Wasserversorgung des Tals innezuhaben. Wochen später, als die Bewohner des kleinen Dorfes Ein Jahoud aufgegeben haben und abgezogen sind, wird es auf dem Berghang neu errichtet, direkt neben den verlassenen Steinhäusern.“ (S. 56) Dass die ursprünglichen Bewohner, vertrieben durch den Wasserentzug, ihre seit Generationen angestammte Heimat verließen, verlassen mussten, wird hier nur in einem Nebensatz erwähnt, als sei es nicht weiter der Rede wert. Was das aber für die betroffenen Menschen konkret bedeutete, für die Familien, die sich von heute auf morgen eine neue Bleibe suchen mussten, wird nicht weiter erörtert. Im Fokus stehen die jungen Kibbuzniks, die sich hier „von Opfern [die sie in der jüdischen Geschichte immer waren] in souveräne, selbstbestimmte und freie Menschen“ verwandelten (S. 61); die dabei aber anderen ihre Souveränität, ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre Freiheit nahmen.
Anders geht Shavit an die Geschichte Huldas heran, das er zusammen mit einem alten palästinensischen Bauern besucht, der um 1948 aus dem nahegelegenen arabischen Dorf Chulda vertrieben worden war und seither in der Westbank lebt; das Dorf wurde – wie es oft geschah – nach der Vertreibung seiner ursprünglichen Bewohner zerstört (s. S. 366). Schon vorher hatte Shavit immer wieder von dem „moralischen Preis“ für die Errichtung des Staates Israel gesprochen und von der „Tragödie“, die er bereits im Untertitel seines Buches nennt. Aber hier, in Hulda, gelangt er – berührt von dem heftigen Schmerz, der den alten Mann überwältigt – endgültig zu der Erkenntnis: „Nach 1800 Jahren eines Lebens in Machtlosigkeit setzten die Juden eine große, organisierte Streitmacht ein, um das Land eines andern Volkes und Dutzende Dörfer […] an sich zu reißen.“ (S. 375) Und er fragt sich: „Kann man von den Palästinensern erwarten, dass sie ihre Forderung, dass den ehemaligen Einwohnern von Chulda Gerechtigkeit widerfährt, fallen lassen?“ (S. 373) Gerechtigkeit aber, auch das wird ihm hier klar, könnte nur dadurch hergestellt werden, dass man den Vertriebenen die Rückkehr in ihre Dörfer ermöglicht (s. S. 360) – in Dörfer, die es aber nicht mehr gibt: Auf ihrem Grund haben die Zionisten ihre eigenen gebaut und auf den Feldern der Palästinenser eigene Äcker bzw. – im Fall Huldas – eines der größten Weingüter des Landes angelegt. So kommt Shavit zu einem sehr pessimistischen Schluss, bei dem er den Namen Chulda als Chiffre verwendet für alle palästinensischen Dörfer, die das gleiche Schicksal erlitten haben: „[Das Problem] Chulda wird bleiben. Und für Chulda gibt es keine Lösung. Chulda sagt: Es wird kein Frieden herrschen im Land Israel.“ (S. 374)
Hart ins Gericht geht Shavit mit der ursprünglich religiös begründeten Siedlerbewegung im Westjordanland (Kap. 8). Ihr Vorgehen erläutert er am Beispiel von Ofra, der „Mutter aller Siedlungen“ (S. 285), deren Gründung anfangs gegen den Widerstand der israelischen Regierung durchgesetzt wurde. Unumwunden nennt er dies „ein sinnloses und anachronistisches kolonialistisches Projekt“ (ebenda). Hatte er Ein Harod und Hulda im Kern noch aus dem historischen Zusammenhang gerechtfertigt, dass die in Europa diskriminierten und verfolgten Juden sich eine Heimstätte schaffen wollten, in der sie in Frieden und Freiheit leben konnten, verhält es sich bei der Besiedlung der Westbank aus seiner Sicht ganz anders: „Ofra ging nicht aus einer verzweifelten Diaspora hervor, sondern aus einem souveränen Staat. Es wollte den Juden keinen Schutz bieten, sondern ihnen ein Königreich erschaffen.“ (S. 290) Und unter Einbeziehung des Gazastreifens schreibt er: „Ich wusste, dass wir es ihnen nicht wegnehmen durften. Keinen Zoll davon, keine einzige Siedlung.“ (S. 363) Die Besatzung ist für ihn eines der größten Probleme; sie müsste unbedingt beendet werden. Im Unterschied zu zerstörten Dörfern wie Chulda, die für Rückkehrwillige verloren sind, gäbe es hier also für Shavit durchaus eine Lösung: den Rückzug der Besatzungsmacht.
Kritisch geht der Autor auch mit dem Verhalten des Staates gegenüber den Palästinensern um, die weiterhin in Israel leben: „Der Staat Israel“, so schreibt er, „weigert sich […], seine arabischen Bürger zu berücksichtigen. Er hat bislang keinen Weg gefunden, dieses Fünftel seiner Bevölkerung vernünftig zu integrieren. Die Araber, die 1948 nicht vertrieben wurden, sind vom Zionismus über Jahrzehnte hinweg unterdrückt worden. Der jüdische Staat hat einen Großteil ihres Landes konfisziert, viele ihrer Rechte mit Füßen getreten und ihnen keine echte Gleichberechtigung zugestanden. In den letzten Jahren hat die Unterdrückung nachgelassen, sie wurde jedoch nicht durch ein echtes Zivilbündnis ersetzt, das den arabischen Bürgern Israels vollständige Rechte zuerkennt.“ (S. 547)
Insgesamt thematisiert der Autor, wie wohl deutlich geworden ist, die Palästina- und Palästinenser-Frage bemerkenswert offen und kritisch. In diesem Zusammenhang sei noch einmal in Erinnerung gerufen, dass sein Buch in Israel mehrere Preise bekommen hat.
Viele Kapitel befassen sich natürlich noch mit anderen Aspekten des Landes, und auch diese Kapitel sind unbedingt lesenswert. Sie behandeln beispielsweise die Plantagen der Jaffa-Orangen (Kap. 3), den Atomreaktor Dimona (Kap.7), das problematische Verhältnis zwischen Aschkenasim (d.h. Juden mit osteuropäischen Wurzeln) und Sephardim (Juden mit orientalischen Wurzeln; Kap. 11), das Nachtleben in Tel Aviv und Erkenntnisse über die israelische Gesellschaft, die Shavit daraus ableitet (Kap. 12), oder die beeindruckenden Erfolgsgeschichten im wirtschaftlichen und besonders im Hightech-Bereich (Kap. 15).
Es ist ein ausgesprochen vielschichtiges und ein ausgesprochen ehrliches Buch.
Vieweger, Dieter:
Streit um das Heilige Land.
Was jeder vom israelisch-palästinensischen Konflikt wissen sollte
Gütersloher Verlagshaus. 7., erweiterte und aktualisierte Auflage 2020. 384 Seiten
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Dieter Vieweger ist Professor für Altes Testament und Biblische Archäologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, Direktor des Biblisch-Archäologischen Instituts Wuppertal sowie Leitender Direktor der beiden Institute des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem und Amman, die zugleich auch Forschungsstellen des Deutschen Archäologischen Instituts sind.
Das Buch von Dieter Vieweger ist eines der umfassendsten Werke zu diesem Thema, das alle relevanten Aspekte behandelt. Eine mehrseitige Chronik spannt den Rahmen von der vorisraelitischen Zeit bis in die Gegenwart. Sehr aufschlussreich ist das zweite Kapitel: „Traditionen und Mythen – Worauf beruft man sich?“ Hier erfährt an etwas über Das Land nach jüdischer Lesart und Das Land nach arabischer Lesart zu erfahren, jeweils eingebettet in den historischen und religiösen Kontext des Judentums auf der einen und des Islam auf der anderen Seite. Das ist sehr hilf-reich, will man die Positionen beider Seiten, der Palästinenser wie der Israelis, verstehen und die Verhärtungen be-greifen, die eine friedliche Lösung des Konflikts seit Jahrzehnten verhindern. In diesem Zusammenhang werden auch die Heiligen Stätten in der südlichen Levante – so laut Vieweger die einzig politisch wie sachlich korrekte Bezeichnung für die Region – in ihrer jeweiligen Bedeutung für die beiden Religionen beschrieben.
Es folgt eine umfassende und detailreiche Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von 1882 – den Judenpogromen im zaristischen Russland – bis zu Trumps Abkehr vom Bekenntnis zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Ausführlich geht der Verfasser auch auf die „Fatah, Hamas und die Frage der Ausrufung des Staates Palästina“ ein. Kapitel über die Bedeutung des „arabischen Frühlings“ sowie des iranischen Atomprogramms für Israel/Palästina weiten den Blick über die Region hinaus. Das letzte Kapitel wagt einen Blick nach vorne: „Resümee und Ausblick – Was kann morgen passieren?“
Längere Auszüge aus historischen Quellen und wissenschaftlichen Texten bieten wichtige und authentische Ergänzungen. Optisch abgehobene Kurzbiografien zahlreicher Persönlichkeiten ergänzen die fortlaufende Darstellung der historischen Ereignisse.
Viele optisch gut aufbereitete Karten sowie zahlreiche historische und aktuelle Fotos machen die Ausführungen sehr anschaulich. Eine neunseitige Auflistung und Erklärung wichtiger Begriffe, mehrere Register und ein Verzeichnis der verwendeten Zitate aus Bibel und Koran runden das Werk ab.
Eines der letzten Kapitel trägt die nicht sehr hoffnungsvolle Überschrift „Die Luft ‚riecht‘ nicht nach Frieden“. Ein Gegengewicht bildet ein Zitat des österreichischen Publizisten Robert Jungk, das als Motto dem Buch vorangestellt ist: „Die Welt kann verändert werden. Zukunft ist kein Schicksal.“
Bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen in der Region und in der Welt das endlich begreifen – ausgewogenen und unter Berücksichtigung der Interesse aller Beteiligten.
Waldman, Ayelet / Chabon, Michael (Hg.):
Oliven und Asche
Schriftstellerinnen und Schriftsteller berichten über die israelische Besatzung in Palästina.
Kiepenheuer & Witsch 2017. 552 Seiten
Ayelet Waldman ist eine us-amerikanisch-israelische Juristin und Schriftstellerin. Ihr Ehemann Michael Chabon ist ein preisgekrönter Romanautor. 2001 erhielt er den Pulitzer-Preis.
„Diese aufsehenerregende Anthologie vereint Essays, Reportagen und Kurzgeschichten von international gefeierten Autoren und bezeugt die Katastrophe, die die israelische Besatzungspolitik für das Westjordanland und Gaza bis heute bedeutet.
Für »Oliven und Asche« haben sich Michael Chabon und Ayelet Waldman, zwei der wichtigsten amerikanischen Schriftsteller unserer Zeit, mit der israelischen Organisation Breaking the Silence zusammengetan. Breaking the Silence wurde von ehemaligen israelischen Soldaten gegründet, die in den besetzten Gebieten gedient und Ungerechtigkeit direkt erlebt haben. Zusammen luden sie im letzten Jahr 26 international renommierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Eva Menasse, Dave Eggers, Mario Vargas Llosa, Colum McCann und Arnon Grünberg ein, sich selbst vor Ort ein Bild von der Lage in den besetzten Gebieten zu machen.
Entstanden sind eindrucksvolle, lebendige Geschichten und Reportagen, die uns den Alltag in Palästina erschreckend klar vor Augen treten lassen. Der Leser reist z.B. mit Rachel Kushner in ein palästinensisches Flüchtlingscamp mitten in Jerusalem, lernt mit Taiye Selasi etwas über die verbotene Liebe zwischen Israelis und Palästinensern oder lässt sich von Helon Habila die verblüffende Genese der Israelischen Sperranlage erzählen.“
(Beschreibung auf der Homepage der Buchhandlung Karola Brockmann, Brühl. Siehe https://brockmann-buecher.buchhandlung.de/shop/article/32875540/oliven_und_asche.html)
Wild, Petra:
Apartheid und ethnische Säuberung in Palästina: Der zionistische Siedlerkolonialismus in Wort und Tat
Promedia Verlagsgesellschaft ³2013. 240 Seiten
Die freiberufliche Publizistin Petra Wild studierte arabische Sprache und Islamwissenschaften in Jerusalem, Leipzig, Damaskus und Berlin.
In ihrem Buch stellt sie zunächst kurz den „Ursprung des Konflikts“ zwischen Israel und Palästina dar, den sie im „zionistischen Siedlerkolonialismus“ sieht. Ausfühlich geht sie dann auf die zahlreichen Facetten der problematischen Beziehungen zwischen den Israelis und Palästinensern ein. Dabei nimmt sie u.a. die Situation der arabischen Israelis in den Blick – also der Araber und Palästinenser, die in Israel leben und offiziell „israelische Staatsbürger arabisch-palästinensischer Herkunft“ genannt werden. Sie schildert ihre Probleme, die nach dem ersten israelisch-arabischen Krieg von 1948 anfingen, und geht auf die schwierige Frage einer „ungleichen Staatsbürgerschaft“ ein. Die Bedeutung und die prekäre Lage Ostjerusalems wird thematisiert, ebenso die Rolle der Siedler in der Westbank, die Wild unter die Überschrift „Landraub und Terrorisierung der einheimischen Bevölkerung“ stellt. Auch die Frage eines „Rassismus in der jüdisch-israelischen Bevölkerung“ wird erörtert.
Die Autorin stützt ihre Darstellung auf zahlreiche Details, wobei ihr wichtig ist, alle ihre Aussagen zu belegen; daher weist das Buch auf gut 220 Textseiten 730 Fußnoten auf, die größtenteils Quellenangaben enthalten.
Abgerundet wird das Buch – außer durch die übliche Literaturliste – durch ein Verzeichnis von „Berichten und Studien von UNO-Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und Studienzentren“, eine Liste von „Zeitschriften, Tageszeitungen, Nachrichtenagenturen und Fernsehsendern“, ein Verzeichnis von „Online-Zeitungen, Webseiten und Blogs“, die sich mit dem Thema beschäftigen, und mehrere Landkarten im Anhang.
Zu Wilds Buch hat der Soziologe Moshe Zuckermann von der Universität Tel Aviv am 5. Juni 2013 in der Süddeutschen Zeitung eine Rezension verfasst (siehe www.sueddeutsche.de/wissen/buchrezension-israels-palaestinenserpolitik-juden-zionisten-israelis-1.1688833). Auch wenn er den von Wild angewandten Begriff des Genozids als taktisch unklug bezeichnet, lobt er, dass sie „kein Blatt vor den Mund“ nehme, und spricht von einem "wichtigen" und „verdienstvollen Buch“ – obwohl es seiner Meinung nach wenig wirklich Neues enthält; denn: „Alles, was darin an empirischem Material zusammengetragen, analysiert und gedeutet wird, konnte schon seit Langem von jedem, der es wollte, gewusst werden.“
Zang, Johannes:
Unter der Oberfläche. Erlebtes aus Israel und Palästina
AphorismA, 5. Auflage 2014. 294 Seiten
Johannes Zang hat mehrfach einige Jahre in Palästina und in Israel verbracht. Dort arbeitete er in einem Kibbuz, in einem Altenheim und in Jerusalem und Bethlehem als Musiklehrer und Musiktherapeut. Außerdem schrieb er als Journalist für die ZEIT und andere Zeitungen. Gegenwärtig ist er vor allem als Reiseleiter tätig.
Im Klappentext seines Buches schreibt er: „Dieses Buch versucht die menschliche Dimension von Besatzung zu beschreiben: Was macht sie mit den Besetzten, und was mit den Besatzern…“
Im Vorwort gibt Zang einen knappen Abriss der Geschichte des Konfliktes zwischen Israel und Palästina. Das Buch ist ansonsten nach den Jahreszeiten in vier Kapitel unterteilt, beginnend mit dem Sommer. Ein kurzer Vorspann macht bei jedem Kapitel deutlich, dass diese Jahreszeiten auch metaphorisch verstanden werden: „Es geht heiß her zwischen Israelis und Palästinensern“ heißt es etwa beim Sommer (S. 11), „Es liegt vieles in der israelischen Bürokratie auf Eis, was das tägliche Leben des palästinensischen Volkes einfriert und lähmt“, beim Winter (S. 169). Jedes Kapitel wird sodann – nach einem ausdrucksstarken und aussagekräftigen Foto – eröffnet durch einen mehrseitigen Erfahrungsbericht verschiedener Personen, die Zang aufgezeichnet hat: Da ist beispielsweise ein Mitarbeiter des Christian Peace Maker Teams (CPT), der das Sommer-Kapitel eröffnet (S. 15 ff.), eine israelische Friedensaktivistin, die sich von ihren Kindern anhören muss, sie sei „keine gute Patriotin“, während sie selbst gerade ihren Einsatz für die Menschenrechte auch der Palästinenser als patriotisches Anliegen versteht (Sommer, S. 115 ff.), die Botschafterin Palästinas in der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Khouloud Daibes (Winter, S. 173 ff.), sowie der Pfarrer der lutherischen Weihnachtskirche in Bethlehem (Frühling, S. 207 ff.).
Damit ist der Akzent des Buches gesetzt: Zang geht stets von konkreten Beobachtungen und Erfahrungen aus, die auch sonst immer wieder einfließen (z.B. seine Erfahrungen als Reiseleiter in Hebron), und auf dieser Grundlage vertieft er die angesprochenen Themen, stellt Hintergründe dar und erläutert Zusammenhänge. Dies macht das Buch ausgesprochen authentisch und gut lesbar.
Eingestreut sind an vielen Stellen Statements von Organisationen, etwa von Amnesty international, und Aussagen von einzelnen Personen, wodurch die Ausführungen einen zusätzlichen Facettenreichtum und zusätzliche Tiefe bekommen. Am Ende findet sich ein mehrseitiges Glossar, in dem u.a. viele Menschenrechtsorganisationen vorgestellt werden.
Zang, Johannes:
Erlebnisse im Heiligen Land
77 Geschichten aus Israel und Palästina. Von Ausgangssperre bis Zugvögel
Promedia Verlagsgesellschaft mbH. 1. Auflage, Oktober 2021. 220 Seiten
Johannes Zang ist Musiktherapeut, Musiklehrer und Organist, Journalist und Buchautor, Reiseleiter und Pilgerführer, Referent für Fragen rund um Palästina und Israel mit 35 Jahren Erfahrung von Land und Menschen vor Ort. All das ist sehr transparent erfassbar auf seiner informativen Website https://jerusalam.info/. Nun hat er sein viertes Buch vorgelegt: nach „Unter der Oberfläche. Erlebtes aus Israel und Palästina“ (5. Aufl. 2014; Besprechung: s.o.), „Gaza – ganz nah, ganz fern“ (2013), „Begegnungen mit Christen im Heiligen Land“ (2017) jetzt also „Erlebnisse im Heiligen Land“.
Eine Minute vor (oder bereits nach) Zwölf?
Die Titel stehen für Zangs Arbeitsstil und Anspruch: die Situation möglichst hautnah erleben, ihren Menschen intensiv begegnen, sie wirklich hören und sehen, zu Wort kommen und sichtbar werden lassen – und reflektieren, die Kulissen der Propaganda durchschauen. Während so noch „alle Parteien“ zum Zuge kommen, ändert sich alles, wenn man wie Zang die Dinge mit einer über die Jahrzehnte heiß gelaufenen Erwartung erlebt; der gläubigen Erwartung, dass die Menschen, die einander hier bekriegen, endlich irgendwie miteinander einen Weg zu einem Leben in Würde finden müssen. Aus der wachsenden Enttäuschung dieser Erwartung erwächst Verzweiflung – oder ein hilfreicher Standpunkt. Der wird umso glaubwürdiger und überzeugender, als ihn ein erklärter Freund Israels und gläubiger Christ einnimmt, der in einem lebenslangen Lernprozess Menschen, die sich als Palästinenser im Unterschied zum Staat der Juden verstehen, gleichfalls kennen, schätzen und lieben gelernt hat. Das führt zu keiner sozialtechnischen Auflösung des generationenlangen Krieges der zwei etwa gleichgroßen Bevölkerungsgruppen im historischen Palästina; aber es macht den Schmerz, den sie einander zufügen und den die technisch haushoch überlegene jüdische Seite, je länger, desto übermächtiger und hasserfüllter, vernichtungsfähiger der arabischen zufügt, immer unerträglicher. Der Autor wird so Partei. Er kann nicht anders.
Das ist nun keine völlige Wende bei Zang, jedoch in dieser Deutlichkeit, Zielgerichtetheit und Dringlichkeit auffällig. Die 77 geschilderten Erlebnisse und Eindrücke verstören einen gerade in ihrem Wechsel zwischen schönen bis interessanten, typisch touristischen Themen (wie Naturphänomenen oder kulturellen, etwa religiösen Besonderheiten der einen wie der anderen Seite) und ausgesprochen erschreckenden Beispielen des Kampfes der israelischen Supermacht gegen die unterlegene palästinensische Seite. Etwa 16 Kapitel sind allgemein kultureller Art, 15 behandeln vorrangig (nicht nur schöne!) Aspekte der arabisch-palästinensischen, 20 vorrangig solche der jüdisch-israelischen Gesellschaft, doch 44 oder knapp 60% behandeln ausdrücklich oder streifen am Rande den asymmetrischen, den ungleichen Kampf des Staates Israel gegen die Hälfte der Bevölkerung in seinem Machtbereich.
Zang belegt seine Informationen sorgfältig und leicht kontrollierbar; jedem Kapitel ist ein gesonderter Abschnitt mit Quellenverweisen zugeordnet, meistens für jeden schnell im Internet auffindbar. Dem schließen sich knapp, aber klar kommentierte Literaturempfehlungen, Filmtipps und Hinweise auf solide Webinare an. Eine Zeittafel zu Ereignissen und Fakten, die die Konfliktträchtigkeit der Region und Beispiele für Versöhnungspotenzial abbilden, schließt das Buch ab, zusammen mit einem so gut wie lückenlosen Namensregister.
Wer wissen will und genauer darauf schauen will, weshalb die herrschende Situation die Stabilität der Region zwischen Jordan und Mittelmeer andauernd und akut bedroht, dem hilft Zang zweifelsohne sehr. Eine Minute vor Zwölf?!? Es liegt an den Entscheidungsträgern in Medien, Kirchen, Parlamenten und Regierungen und am Druck der Zivilgesellschaften, dass es nie Zwölf wird.
Rezension: Dr. Michael van Lay-Exeler
Zertal, Idith / Eldar, Akiva:
Die Herren des Landes. Israel und die Siedlerbewegung seit 1967
DVA 2007. 572 Seiten
Idith Zertal ist eine israelische Geschichtsprofessorin. Sie lehrt derzeit am privaten Interdisciplinary Center Herzliya nördlich von Tel Aviv und an der Hebräischen Universität Jerusalem. Zahlreiche Lehraufträge im Ausland, u.a. an der Universität Chicago, der Universität Basel und der Hochschule für Sozialwissenschaften in Paris. – Akiva Eldar war Sprecher des früheren Jerusalemer Bürgermeisters Teddy Kollek und arbeitete 35 Jahre lang als Leitartikler und Kolumnist der israelischen Tageszeitung Haaretz, deren Washingtoner Büro er viele Jahre leitete.
Zertal und Eldar beschreiben in diesem Buch detailliert die Geschichte der Besiedlung des Westjordanlandes durch religiöse israelische Siedler von 1967 bis 2006.
In der Darstellung kristallisieren sich einige grundlegende Aspekte und Entwicklungslinien heraus, die sich durch das ganze Buch ziehen, und zwar hinsichtlich
- der Rolle einiger tonangebender Rabbiner und ihrer Jeschiwot (= Thora-Schulen; Singular: Jeschiwa)
- der Strategien der Siedler bei der Inbesitznahme palästinensischen Landes sowie
- ihrer komplexen Beziehungen zu den verschiedenen Regierungen und dem Militär.
Hinsichtlich der ROLLE DER RABBINER ist vor allem Rabbi Zvi Jehuda Kook (sprich: „Kuk“) zu nennen. Zusammen mit seinem Vater Avraham Yitzhak Kook, dem ersten aschkenasischen Großrabbiner in Palästina, gilt er als der eigentliche Inspirator der Siedlerbewegung. Aus seiner – bereits vom Vater gegründeten – Jeschiwa Merkas HaRaw in Jerusalem sind viele der späteren Siedlerführer hervorgegangen (S. 217 ff.).
Für ihn stand – wie für viele andere Rabbiner – außer Frage, dass der Staat Israel nicht nur das Gebiet umfassen sollte, das der UNO-Teilungsplan vom November 1947 dafür vorgesehen hatte, sondern auch das Westjordanland, das nach demselben Teilungsplan für einen künftigen Staat Palästina gedacht war. Er strebte also ein „Großisrael“ an. Einer breiteren Öffentlichkeit stellte er diese Position Anfang 1974 in der Jerusalem Post vor. Unter der Überschrift That All People of the Earth May Know schrieb er: „Dieses gesamte Land ist unser, absolut, gehört uns allen; es ist nicht auf andere zu übertragen, selbst in Teilen nicht.“ „Damit“, so Kook weiter, „ist ein für allemal klar und unumstößlich, dass es keine ‚arabischen Gebiete‘ oder ‚arabischen Ländereien‘ gibt, sondern einzig und allein die Erde des Landes Israel, das ewige Erbe unserer Vorväter, auf das andere gezogen sind und auf ihm gebaut haben, ohne unsere Erlaubnis und in unserer Abwesenheit.“ (S. 241 f.) Nicht die israelischen Siedler sind also hier die Besatzer, sondern die Palästinenser – eine bemerkenswerte Umkehrung der Begriffe. In dieser Sicht ist es dann folgerichtig, dass die Landnahme durch die Siedler als Befreiung oder gar Erlösung des Landes beschrieben wird. Diese „Erlösung“, so Kook wenig später, sei „ein göttliches Gebot, das unter Todesstrafe befolgt werden muss“ (S. 242). Und selbstverständlich steht das göttliche Gebot für ihn über jedem staatlichen Gesetz, wie der anschließende Satz deutlich macht: „kein politisches Ermessen, keine Regierungskungeleien und keine Verlautbarungen unserer Minister werden daran etwas ändern“ (ebenda). Hier wird – neben dem Gedanken der Ausweitung des Landes – die zweite Konstante in Kooks Denken deutlich: Die Herrschaft der Halacha, des traditionellen jüdischen Rechts, und das steht eben über jedem staatlichen Recht. Was Kook anstrebte, war demnach nicht nur ein Großisrael, sondern ein „Priesterkönigreich“, „ein Staat, der sich von jedem ‚gewöhnlichen Staat‘ unterscheiden“ würde (S. 223) – keine Demokratie, sondern eine Theokratie.
Hinsichtlich der Wirkung solcher Äußerungen urteilen Zertal und Eldar: „Aus historischer Perspektive betrachtet, war und bleibt der Einfluss, den Zvi Jehuda Kook auf die israelische Gesellschaft und die Geschichte des israelischen Staates gehabt hat, dank seiner Anhänger umfassender und tiefer als der jeder anderen religiös-spirituellen Persönlichkeit“ (S. 222). Auf diese Anhänger habe die „ungehemmte Erlösungsrhetorik […] wie eine berauschende Droge“ (S. 230) gewirkt.
Gut einen Monat nach dem Artikel in der Jerusalem Post wurde in der Siedlung Kiryat Arba bei Hebron die Siedlerorganisation Gush Emunim (= Bund der Getreuen) gegründet (S. 233 ff.); sie wurde zu der Siedlerorganisation schlechthin. Kooks Positionen bildeten ihr geistiges Fundament, die religiöse Ideologie der ersten Siedlergenerationen. Sie gab ihnen die Gewissheit, auch bei Konflikten mit staatlichen Stellen immer im Recht zu sein: Sie hatten schließlich das göttliche Recht auf ihrer Seite. Das erklärt das Fehlen jeglicher Selbstzweifel nicht nur bei Verstößen gegen staatliche Weisungen, sondern auch bei ihrem oft menschenverachtenden Verhalten gegenüber den Palästinensern.
Bei ihren Aktionen entwickelten sie einige sehr effektive STRATEGIEN. Die wichtigste bestand darin, Fakten zu schaffen, hartnäckig und ausdauernd. Das beschrieb Rabbi Moshe Levinger, ein Schüler Kooks, der im Frühjahr 1968 die erste Siedlergruppe in Hebron anführte, 20 Jahre später in Haaretz mit bemerkenswerter Offenheit: „Das war unsere Strategie: nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern genau das Gegenteil, die Aktion hinzuziehen, bis sie am Ende akzeptiert würde […] Timing war immer von Bedeutung für uns, weil die verstreichende Zeit zu unseren Gunsten arbeitete. Man [gemeint: die Behörden] gewöhnte sich einfach an die Fakten vor Ort.“ (S. 7) Anhand vieler Beispiele beschreiben Zertal und Eldar, wie erfolgreich diese Strategie immer wieder angewendet wurde. Ergänzt wurde sie durch ein ganzes Repertoire weiterer Maßnahmen: Beispielsweise wurden Straßenblockaden und Massendemonstrationen sehr medienwirksam inszeniert, wenn etwa doch einmal die Räumung einer auch offiziell als illegal eingestuften Siedlung drohte. (Zur geschickten Zusammenarbeit mit den Medien s. den Abschnitt „Medienjongleure“, S. 251 ff.)
Bei allen Aktionen war von Anfang an eine ausgeprägte Gewaltbereitschaft der Siedler zu beobachten, wie das Bild auf dem Schutzumschlag des Buches bereits signalisiert. Und auch sie war von religiösen Autoritäten legitimiert. So erklärte Rabbi Yitzhak Shilat: „Alles, was wir aus einer seelischen Notlage und Wut heraus tun, sogar töten, ist gut, ist akzeptabel und wird helfen.“ (S. 132) Und es sei durchaus „statthaft, ein arabisches Geschäft niederzubrennen als Antwort auf einen Angriff gegen Juden.“ (S. 133) Zusammenfassend halten die Autoren fest: „Die Siedler erlaubten sich vorzugehen, als gäbe es überhaupt kein Gesetz, und taten, was immer sie in den besetzten Gebieten für nötig erachteten.“ (Dazu weiter unten über die Justiz)
Die BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN SIEDLERN UND STAATLICHEN STELLEN war sehr komplex und höchst ambivalent. Seitens des Staates gab es immer wieder Versuche, die Siedleraktivitäten zumindest einzudämmen. Beispielsweise gab es seitens des Staatsrevisors mehrfach massive Vorwürfe wegen illegaler Siedlungstätigkeiten, Verschwendung von Steuergeldern und sogar Korruption im zuständigen Ministerium (s. z.B. S. 142). Aber die Siedler waren in Regierungs- und Verwaltungskreisen hervorragend vernetzt und fanden auf den verschiedenen Ebenen der Bürokratie stets Befürworter und Unterstützer, die sich letztlich als durchsetzungsstärker erwiesen als die Kritiker.
Einer der eifrigsten Unterstützer war Ariel Scharon, in der ersten Likud-Regierung unter Menachem Begin (ab 1977) Landwirtschaftsminister und Vorsitzender im Ministerialausschuss für Siedlungsbelange, von 2001-2006 Ministerpräsident. Zertal und Eldar nennen ihn den „Schutzengel der Siedler seit 1974“ (S. 82; sehr ausführlich über seine Rolle S. 443 ff.). Sein Ziel war radikal: „Die unverhohlene Absicht hinter Sharons ‚Erlösung des Landes‘“, so führen sie aus, „war, für alle Zukunft die Möglichkeit der Errichtung eines lebensfähigen und über eine annehmbare territoriale Geschlossenheit verfügenden palästinensischen Staatswesens zunichte zu machen“ (S. 85) und „jeden denkbaren Friedensvertrag zu torpedieren“ (S. 480). Mittel zum Zweck waren eine möglichst breite Streuung der Siedlungen (s. z.B. S. 83) und der Bau von Straßen, „die allein den Siedlern zur Verfügung standen“ (S. 86) und bis heute stehen. „Das Land der Palästinenser wurde zerstückelt, der Länge und Breite nach auseinandergerissen und von den Siedlern und Israels Regierung geraubt.“ (ebenda) Sharon ging in seiner Unterstützung der Siedler sogar so weit, dass er Stellung bezog gegen den Obersten Gerichtshof: Als dieser wieder einmal Regierung und Armee anwies, Siedler von palästinensischem Land zu vertreiben, forderte er, „die Regierung müsse ‚ein Team aus Rechtsexperten‘ benennen, das die Siedlungen gegen die Einmischung des Obersten Gerichtshofs ‚immunisiert‘“ (S. 401 f.; Zitat S. 402). Es war – wohlgemerkt – der amtierende Landwirtschaftsminister, der hier ein Urteil des Obersten Gerichtshofs als „Einmischung“ brandmarkte.
Insgesamt gesehen übernahmen die siedlerfreundlichen staatlichen Stellen übrigens die oben beschriebene „Hauptstrategie“ der Siedler: So versicherte man immer wieder gegenüber dem Ausland, das den Siedlungsbau durchaus kritisch sah, man werde diesen beenden; gleichzeitig unterstützte man aber massiv weitere Baumaßnahmen und schuf so vor Ort vollendete Tatsachen.
Eine besondere Beziehung bestand von Anfang an zwischen den Siedlern und dem Militär: Dieses hatte die Aufgabe, die Siedler – also die Eindringlinge – vor den Palästinensern zu schützen, die ihr Eigentum verteidigten. Die Unterstützung der Siedlungstätigkeit wurde in diesem Zusammenhang gerne damit begründet, dass die Siedlungen sicherheitspolitisch relevant, ja geradezu unverzichtbar seien – als Bollwerke gegen Angriffe der Araber auf den Staat Israel. Aber selbst manche Vertreter des Militärs bezweifelten das und sahen für diese Behauptung nur einen einzigen Grund: „Eine Rechtfertigung zu liefern für die Einnahme des Landes, die auf keine andere Weise zu rechtfertigen gewesen wäre.“ (S. 397. Die enge Zusammenarbeit mit der Armee wird ausführlich in dem Kapitel „Komplizenschaft“, S. 309 ff., dargestellt.)
Kam es zu Konflikten, hatten die Palästinenser grundsätzlich schlechte Karten. Das lag an bestimmten Aspekten des Justizsystems: Für die Siedler waren die israelischen Zivilgerichte zuständig, für die Palästinenser aber Militärgerichte. Diese ahndeten Tätlichkeiten der Palästinenser grundsätzlich sehr hart, solche der Siedler aber wurden sehr milde bestraft – wenn sie überhaupt zur Anklage kamen. Zertal und Eldar beklagen „eine massive Ungleichstellung zwischen den Palästinensern und den Siedlern“ (S. 414) in rechtlicher Hinsicht: „Die jüdischen Siedler führten sich auf, als gehörten die Gebiete einzig und allein ihnen, und das israelische Rechts- und Justizsystem spielte mit, sowohl aktiv wie passiv“ (S. 416). Zusammenfassend sprechen sie von einer „Erschöpfung und Kapitulation des gesamten Rechtssystems vor dem herrischen Auftreten der Siedler“ (S. 433. Ausführlich über die Justiz Kap. 7: „Im Lande Israel ist alles legal“ – gemeint ist: für die Siedler; S. 371 ff.).– Was hier über das Justizsystem gesagt wird, ist bis heute Realität.
Noch eine ganze Reihe weiterer Themen wird in dem Buch ausführlich behandelt, etwa das System der illegalen Außenposten, als dessen Erfinder ebenfalls Sharon gilt (s. S. 479) und mit dem die Siedlungen immer weiter ausgedehnt wurden; die terroristischen Aktivitäten des Jüdischen Untergrunds (S. 102 ff.), der u.a. die Sprengung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee plante, um den Tempelberg von allen muslimisch-arabischen Spuren zu „reinigen“ (S. 105 ff.); die Bedeutung eines ausgeprägten Todeskults und einer Opfermythologie unter den Siedlern (Kap. 5: „Es lebe der Tod“; S. 276 ff.); die gewaltsamen Proteste der Siedler gegen Friedensbemühungen wie etwa die Oslo II-Verträge über die Westbank; der Trennzaun (S. 456 ff.) und die Bewegung der äußerst aggressiven Hügeljugend (S. 485 ff.).
Beinahe wie der „Film zum Buch“
Der Dokumentarfilm Die Siedler der Westbank, den der israelische Regisseur Shimon Dotan 2016 herausbrachte, wirkt über weite Strecken wie der Film zu dem oben besprochenen Buch: Vieles von dem, was Zertal und Eldar darstellen, ist hier filmisch dokumentiert und Akiva Eldar, einer der beiden Buchautoren, kommt auch mehrfach zu Wort. Darüber hinaus bietet der Film zahlreiche ergänzende Informationen. Interviews sowohl mit Palästinensern als auch mit Siedlern verdeutlichen nicht nur die unterschiedlichen Standpunkte der beiden Seiten, sondern zeigen z.T. auch in erschreckender Deutlichkeit deren Unvereinbarkeit.
Der Film Die Siedler der Westbank ist auf YouTube zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=zOqbG9j6kNc
Dauer: 1 ½ Stunden
Leider unter dieser Adresse nicht mehr zugänglich
Zuckermann, Moshe:
„Antisemit!“ Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument
Promedia Verlagsgesellschaft, 4. Auflage 2015. 208 Seiten
Der in Tel Aviv geborene Moshe Zuckermann, der in Frankfurt am Main studiert hat, ist ein israelischer Soziologe und Professor für Geschichte und Philosophie an der Universität Tel Aviv sowie wissenschaftlicher Leiter der Sigmund-Freud-Privatstiftung in Wien.
Zuckermann kritisiert die allzu vorschnelle und ideologisch motivierte Verwendung des Antisemitismus-Begriffs, der seiner Meinung nach „zum inflationierten Schlagwort polemischer Schlammschlachten degeneriert“ ist (S. 10 f.).
Im ersten Teil seines sprachlich nicht ganz einfachen Buches setzt er sich kritisch damit auseinander, wie der Staat ISRAEL mit dem Phänomen und dem Begriff „Antisemitismus“ umgeht. In Bezug auf das Phänomen einer real existierenden Judenfeindschaft vertritt er die These, dass es den „Sachwaltern des Zionismus“ „nicht um die konsequente Eliminierung des Antisemitismus in der Welt ging […], sondern um die zionistische ‚Antwort‘ auf diesen bzw. die vom Zionismus angebotene Lösung des ‚jüdischen Problems‘ [= die Gründung des Staates Israel], welches – willkommener Weise – auf den in der Welt grassierenden Antisemitismus zurückgeführt werden konnte.“ (S. 14 f.). Der Autor spricht von einer „fortgesetzten Instrumentalisierung der Shoa für heteronome Belange“ (S. 22), nämlich die Durchsetzung und Verteidigung der Politik Israels, und von „narzisstischer Selbstviktimisierung […] in Israels politischer Kultur“ (S. 33).
Den Beginn einer Verwendung des Begriffs Antisemitismus als Schlagwort in der kritischen Auseinandersetzung mit der Politik Israels gegenüber den Palästinensern sieht Zuckermann im Rahmen der dritten „Weltkonferenz gegen Rassismus, rassistische Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz“, die unter der Leitung der Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, vom 31. August bis 7. September 2001 in Durban/Südafrika abgehalten wurde. Der spätere israelische Außen- und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman habe hier den Beginn eines „neuen Antisemitismus“ konstatiert (S. 40 f.). Damit habe er jedoch in unzulässiger Weise Antizionismus und Antisemitismus gleichgesetzt (S. 41). Hier liegt in den Überlegungen Zuckermanns die Verbindung mit dem ersten Aspekt des Antisemitismus: der Reaktion auf das real existierende Phänomen von Judenfeindschaft (s.o.). Dabei geht der Autor mit der Politik Israels hart ins Gericht: Israel prangere „ – die eigene Geschichtskatastrophe instrumentalisierend –, einen mit realer Zionismus- und Israelkritik gleichgesetzten ‚Antisemitismus‘ theatralisch“ an, „ohne sich die geringste Rechenschaft darüber abzulegen, was seine eigene politische und militärische Praxis an Verbrechen gezeitigt hat, und ob der vorgebliche [!] ‚Antisemitismus‘ nicht etwas mit ebendiesen Verbrechen und mit der systematischen Leugnung dieser Verbrechen seitens Israels zu tun hat“ (S. 52). Stattdessen werde jeder Kritiker undifferenziert als „neuer Antisemit“ abgestempelt (s.S. 42). Beispielsweise werde Europa bzw. die Europäische Union „des ‚Antisemitismus‘ geziehen […], sobald es sich anmaßt, eine Kritik an Israels Politik gegen die Palästinenser zu üben“ (S. 67). Einer Politik, die Zuckermann als „Jahrzehnte währende Okkupationspolitik“ bezeichnet – „gewalttätig, mörderisch und barbarisch“ (S. 27).
Eine undifferenzierte Anwendung des ebenso billigen wie in der Sache ungerechtfertigten „Antisemitismus“- Vorwurfs zur generellen, plakativen Abwehr jeglicher Israel-Kritik sollte mit diesen Ausführungen eigentlich obsolet sein; allzu leicht ist sie als taktisches Manöver zu durchschauen.
Tatsächlich werden aber selbst „israelische Menschenrechtsaktivisten […] ob ihres Kampfes um elementare Wahrung von Menschenrechten in Israel als ‚Antisemiten‘ geschmäht“, so der Autor (S. 85).
In einem zweiten Teil geht Zuckermann darauf ein, wie DEUTSCHLAND sich gegenüber der Politik Israels verhält. Er verweist auf die nationalsozialistische Vergangenheit als Erklärung für Zurückhaltung mit kritischen Äußerungen, geht auf die Walser-Bubis-Debatte ein und stellt den Umgang selbst mit jüdischen Kritikern der israelischen Politik – wie beispielsweise Norman Finkelstein – dar, deren Auftritte gerne verhindert werden. Trotz der historischen Begründbarkeit einer solchen Haltung sieht er diese jedoch grundsätzlich kritisch und beklagt eine „Vorauseilende Selbstzensur“ – so die Überschrift seines letzten Kapitels. Gut zusammenfassen lässt sich Zuckermanns Kritik in dem Satz: „Vor lauter Antisemitismus-Jagd ist inzwischen jeder und jede im deutschen öffentlichen wie halböffentlichen Raum tendenziell dem drohenden Vorwurf ausgesetzt, manifest oder latent antisemitisch zu sein, wobei die keulenartige Drohgebärde so wirkmächtig geworden ist, dass viele in eingeschüchtert-vorauseilender Unterwerfung die perfiden Regeln des Katz-und-Maus-Spiels verinnerlicht haben und ihnen nichts dringlicher erscheint, als dem Vorwurf dessen, was ihnen gar nicht in den Sinn gekommen war, entkommen zu sollen“ (S. 104) – Folge der „versierte[n] Taktik des ideologisch vereinnahmten Antisemitismus-Vorwurfs“ (S. 153).
Ein sehr einfaches Rezept für eine effektive und nachhaltige Bekämpfung der Israel-Kritik, die ja die Grundlage ist für jeden fragwürdig-taktischen Antisemitismus-Vorwurf, hält Zuckermann übrigens auch bereit. Mit Bezug auf die Beteuerung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu – z.B. in einer Rede am 24. September 2009 vor der UN-Vollversammlung – ganz Israel wolle den Frieden, schreibt er:
„Israel will schon immer den Frieden, es will nur nicht den Preis für ihn zahlen. […] Israel hat die Gebiete der Palästinenser okkupiert; Israel allein hat es in der Hand, diesen Zustand aufzuheben.“ (S. 36)
Moshe Zuckermann hat auch eine Rezension zu dem Buch „Apartheid und ethnische Säuberung in Palästina“ von Petra Wild geschrieben; siehe dort!